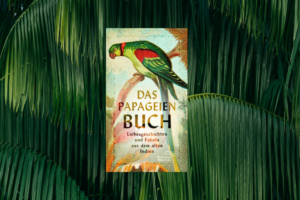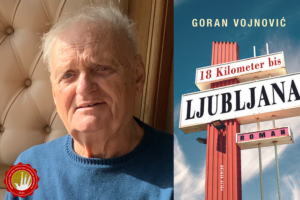2020 erschien die Biografie Ihres Vaters Hosein Zaeri-Esfahani: Wer weiß, wofür das gut war …, die Sie selbst aus dem Persischen übersetzt haben. Wie kam es zu diesem Projekt?
Alles fing im Jahr 2000 an. Da schrieb mein Vater seine Memoiren auf und bat mich, diese zu übersetzen. Es handelte sich um ein persisches Manuskript mit rund 400 getippten Seiten in eng geschriebener Schrift. Doch das war zeitlich gesehen genau in meinen beruflich wilden Jahren, in denen ich als Sozialpädagogin und ehrenamtliche Vorsitzende des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg einen Zehn- bis Zwölf-Stunden-Tag hatte. Es war die Zeit, in der wir hier Perspektiven für die Geflüchteten des Balkankrieges suchen mussten und mit einer Masse von Altfällen kurdischer Geflüchteter vor der türkischen Gewalt konfrontiert waren. Dazu kamen dann noch die Anschläge des 11. September, die eine grausame Zäsur in der europäischen Flüchtlingspolitik mit sich brachten und noch heute die Toten im Mittelmeer verantworten. Es gab wirklich viel zu tun. So musste das Manuskript leider warten. Genau 20 Jahre!
Warum hat Ihr Vater für die Übersetzung seiner Memoiren gerade Sie ausgewählt – und keins Ihrer Geschwister oder jemanden, der sich beruflich mit Literaturübersetzen beschäftigt?
Schon in Iran stellte sich heraus, dass ich sprachlich sehr begabt bin. Eineinhalb Jahre nach unserer Ankunft in Deutschland beherrschte ich die deutsche Sprache bereits so gut, dass ich meinen deutschen Mitschüler*innen in Grammatik und Diktat Nachhilfe gab. Alle dachten, dass ich nach dem Abitur Germanistik oder Linguistik studieren würde. Doch dann entschied ich mich im letzten Moment für Sozialpädagogik. Das Schreiben wurde bei dieser Tätigkeit zu meinem wichtigsten Werkzeug. Alles, was ich machte, drehte sich um Sprache. Da war es naheliegend, dass ich die Biografie übersetzen musste.

War das Buch Ihre erste Erfahrung mit dem literarischen Übersetzen?
Ja, das war meine erste und letzte Erfahrung mit dem Übersetzen. Ich muss sagen, dass ich Literaturübersetzer*innen sehr bewundere und ehre. Um übersetzen zu können, muss man eine gewisse lineare Fähigkeit haben, so als würde man auf eine Kette Perlen aufziehen. Man muss schon vorher wissen, wann welche Perle drankommt, damit man nicht wieder alle Perlen rausziehen muss, wenn man eine falsch aufgefädelt hat. Das ist dieselbe Fähigkeit, die auch Krimiautor*innen beherrschen, glaube ich. Und ich bin nun ganz sicher, dass ich diese Fähigkeit nicht zu den meinigen zählen kann. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich bin eher eine von denen, die in Clustern denkt und arbeitet, also alles gleichzeitig macht. Das Literaturübersetzen überlasse ich gerne denjenigen, die es gut können.
Wie lange hat die Arbeit an der Übersetzung gedauert?
Ich begann am 1. Januar 2019 und reichte am 1. Oktober desselben Jahres das fertige Manuskript beim Grafiker ein. Es dauerte so lange wie eine Schwangerschaft. Für die reine Übersetzung und für das Schreiben brauchte ich neun Monate. Im Winter und Frühling musste ich zum Bestreiten meines Lebensunterhaltes weiterhin mit meinen Erzählstunden und meiner DENKwerkstatt deutschlandweit auftreten. Aber dafür konnte ich die vielen Bahnfahrten zum Arbeiten nutzen. Natürlich war ich auch sehr dankbar um das Stipendium, das ich vom Förderkreis deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg für dieses Buchprojekt erhalten habe.
Wie sind Sie bei der Recherche vorgegangen? Konnten Sie auch Erkundungsfahrten nach Isfahan unternehmen, wo ein großer Teil des Buches spielt?
Einmal Flüchtling, immer Flüchtling! Ich habe die Hoffnung aufgegeben, meine Geburtsstadt je wiederzusehen. Leider konnte ich vor Ort nicht recherchieren. Doch wozu gibt es heute Google-Earth, Youtube, Wikipedia und all die anderen Seiten, wo man alles findet, was man braucht. Ich ging auf der uralten 33-Bogen-Brücke in Isfahan spazieren. Ich fand heraus, wann und wie in den 60er Jahren die Dattelernte in der iranischen Provinz Buschehr, einer der heißesten Orte der Welt, vonstattenging. Ich fuhr mit dem Jeep durch den reißenden Fluss Dalaki und ich fand heraus, welche Uniform die Grenzsoldaten der DDR am 25. Dezember 1985 trugen, als wir als Flüchtlinge im Ostberliner Tränenpalast landeten. Dafür musste ich nur im DDR-Nostalgieshop eine Postkarte bestellen. Auf einer Internetseite fand ich eine Liste aller iranischen Erdbeben seit 1950 auf den Tag genau mit der Zahl der Toten und der Stärke des Bebens.
Ich machte tatsächlich eine Zeit-und-Ort-Reise in die Kindheit meiner Eltern und in meine Heimat. Bevor ich überhaupt entschied, die Memoiren zu übersetzen, hatte ich bereits zwei Jahre lang dazu recherchiert, denn ich wollte ursprünglich das Rohmaterial meines Vaters für einen Zeitreise-Jugendroman nutzen. Doch nach zwei Jahren Recherchieren und Schreiben erkannte ich, dass das Konzept nicht aufging, und gab meinen Zeitreise-Jugendroman vorerst auf. Das tat sehr weh, und ich brauchte erst einmal drei Monate Abstand, bis ich in der Silvesternacht zusammen mit meiner Schwester die gemeinsame Idee entwickelte, dieses Rohmaterial tatsächlich einfach zu übersetzen. Unsere beiden Brüder waren sofort begeistert von der Idee. Wir wussten alle, dass dieses Projekt sehr ambitioniert sein würde. Denn wir wollten unbedingt im Januar 2020, zum 80. Geburtstag unseres Vaters, das fertige Buch in den Händen halten. Wir hatten also nur ein Jahr Zeit. So teilten wir die Aufgaben auf und machten uns sofort an die Arbeit. Hätte ich nicht schon vorher so viel recherchiert, hätte ich niemals in so kurzer Zeit übersetzen können.
2016 haben Sie mit Das Mondmädchen und 33 Bogen und ein Teehaus zwei eigene autobiografisch geprägte Bücher geschrieben. Hat das Ihre Arbeit an der Übersetzung beeinflusst? Und was nehmen Sie für sich persönlich aus dem Übersetzen mit?
Dieses Buch war der Abschluss meiner achtjährigen Autobiografie-Trilogie, so dass ich mit meiner eigenen Geschichte Frieden schließen konnte, um jetzt endlich von mir selbst wegkommen und fiktive Geschichten oder noch mehr Biografien schreiben zu können. Diese Übersetzung war mein Weg, mich endgültig in mein eigenes Leben zu integrieren und den Platz zu finden, wo ich gerne bin.
Wie ist es, die Lebenserinnerungen des eigenen Vaters zu übersetzen – macht es Sie stolz oder war es auch eine Bürde? Ist man ehrfürchtiger als sonst – oder gerade kritischer?
Als er mich vor 20 Jahren fragte, ob ich für ihn übersetzen würde, war es für mich ausschließlich eine Bürde. Ich hatte einen solch großen Respekt vor dem Leben dieses Mannes, dass ich wie gelähmt war. Auch die persische Sprache machte mir große Angst, weil ich mich in Deutschland nicht integriert, d. h. sowohl das Eigene bewahrt als auch das Neue aufgenommen hatte. Ich hatte mich leider nur assimiliert und dadurch alles Iranische geleugnet und mein Persisch fast verlernt. Erst als ich Mutter wurde und mit meinen Kindern zumindest in den ersten drei Jahren nur Persisch sprach und erst als ich anfing, herauszufinden, wer ich überhaupt bin, also mir meiner eigenen Geschichte bewusst wurde, auch durch meine zwei autobiografischen Romane, hatte ich genug SelbstBEWUSSTSEIN, um mir zu erlauben, über das Leben eines anderen Menschen – hier meines eigenen Vaters – zu schreiben. Und dann war es schließlich für mich eine einzige Freude voll Leichtigkeit, tief in diese iranische Schatzkiste eintauchen und all die Edelsteine und Diamanten, die ja auch mir und meinen Kindern gehören, entdecken und für die Leser*innen schleifen zu dürfen.
Haben Sie nah am Ausgangsmaterial übersetzt oder an manchen Stellen auch mal stärker eingegriffen? Und kann man als Tochter überhaupt neutral bleiben?
Bei dieser Frage muss ich lachen. Wer das Buch liest, versteht warum. Mein Vater ist ein sehr besonderer Mensch. Positiv ausgedrückt, kann man sagen, dass er ein sehr vernunftbegabter und nüchterner Mensch ist. Er sieht die Dinge sehr sachlich und neigt nicht zu Dramatisierungen. Als Naturwissenschaftler und Arzt sind ihm diese Charaktereigenschaften enorm zuträglich. Doch seine Autobiografie glich eher einer tabellarischen wissenschaftlichen Zusammenfassung. Es wäre für alle sehr schlecht gewesen, wenn ich neutral geblieben wäre (lacht). Selbst die emotionalsten oder schlimmsten Momente schrieb er als eine Art neutralen journalistischen Text. Etwa die Stelle, an der er als Achtjähriger auf dem Schahplatz in Isfahan das Fahrradfahren lernte. Diese Stelle hatte er in einem einzigen Satz abgehandelt. Doch ich wunderte mich, wie er sich an dieses normale Ereignis erinnern kann oder besser gefragt, warum? Da hat er mir erst erzählt, was es damals bedeutete, wenn eine Frau ohne männliche Begleitung auf Plätzen herumsaß und dass seine Mutter dies trotzdem tat und alle Konsequenzen ertrug, weil sie unbedingt wollte, dass er mit der Zeit geht und Fahrradfahren lernt. Für die Beschreibung dieser Episode brauchte ich etwa eintausend Worte. Also, Gott sei Dank bin ich nicht neutral geblieben als Übersetzerin. Ich habe all die wahrheitsgetreuen Emotionen, Übertreibungen, Extreme und dramaturgischen Momente, die eine gute Geschichte hat und braucht, später beim Übersetzen wieder eingebaut.
Außerdem musste ich einige Fußnoten setzen, wo ich bestimmte Orte, Gegenstände, Traditionen oder Gegebenheiten erkläre. Bestimmte Denkens- oder Verhaltensweisen habe ich nicht erklärt, denn diese können die Leser*innen intuitiv nachvollziehen, wenn man mit Stilmitteln und schriftstellerischen Tricks, wie z. B. Rückblenden oder Dialogen, arbeitet.
Gab es auch Episoden, an die Sie andere Erinnerungen hatten als Ihr Vater? Was haben Sie in solchen Fällen getan?
Ja, es gab da sehr viele Details, die ich in meinen Autobiografien anders beschrieben hatte. Ich erinnerte mich z. B. nur an zwei Koffer, die wir auf der Flucht mit uns herumschleppten. In Wahrheit waren es vierzehn! Daran konnte ich mich wohl deshalb nicht erinnern, weil ich die damals nicht selbst geschleppt habe. Ich habe in diesen Fällen immer das aufgeschrieben, was mein Vater berichtete. Wir wissen alle, dass keine Autobiografie zu einhundert Prozent „richtig“ ist und dass immer die Wahrnehmung der erzählenden Person uns allen einen Streich spielt.
Im Interview mit der Buchbloggerin juliliest sagen Sie, Sie kommen aus einer Familie von Geschichtenerzählern. Wie prägt das Ihre Arbeitsweise als Autorin bzw. Übersetzerin?
Das Geschichtenhören als Kind und später das Geschichtenerzählen als erwachsene Person verändert den Schreibstil komplett. Beim Vorlesen eines Buches gibt es genau eine Vorlage, nämlich das geschriebene Buch. Beim Erzählen gibt es unzählige Möglichkeiten. Orientalisch geprägte Erzählende sind zudem mit der Eigenschaft der Schicksalsergebenheit gesegnet, so dass das Erzählen in der Regel kein Ziel hat, sondern aus dem Prozess des Erzählens an sich und aus den zahlreichen Unterbrechungen und Anmerkungen der Zuhörenden besteht. Deshalb ist das Unterbrechen auch so gern gesehen in diesen Kulturen. Der Weg ist das Ziel, und wenn der Weg sich durch Einflüsse von außen verändert, ist es gut so. Denn man weiß nie, wofür das gut ist. Dies führt dann tatsächlich auch zu einer bestimmten Haltung beim Schreiben. Nämlich zu einer Gelassenheit, weder linear noch chronologisch arbeiten zu müssen, wie etwa mehrere Stellen gleichzeitig zu übersetzen, zu schreiben, Zeitsprünge zu machen und etwas bereits Geschriebenes zu löschen, zu ergänzen, umzukehren, zu verändern oder komplett herauszuschneiden und an einer ganz anderen Stelle des Textes wieder einzusetzen. Das durfte ich machen, da ich wusste, dass mein Vater mir absolut vertraut.
Auch wenn ich Bücher schreibe, arbeite ich auf diese Weise. Ich bin eine sogenannte Bauchschreiberin. Ich arbeite an mehreren Kapiteln gleichzeitig und weiß auch vorher gar nicht, was in dem jeweiligen Kapitel passieren soll. Ich bin nur froh, wenn ich am Anfang des Schreibprozesses weiß, wer Protagonist und wer Antagonist sein soll und wie und wo die Geschichte ungefähr enden soll. Aber das muss auch nicht unbedingt sein.
Ihr Buch 33 Bogen und ein Teehaus, ist vor kurzem mit Förderung des Goethe-Instituts aus dem Deutschen ins Arabische übersetzt worden. Haben Sie dabei als Autorin auch mit der Übersetzerin zusammengearbeitet?
Natürlich! Es hat sehr großen Spaß gemacht, mit Heba Shalaby zusammenzuarbeiten. Sie hat mich angeschrieben, wenn sie nicht genau wusste, was ich an einer Stelle gemeint hatte, da ich ja auch gerne mit Metaphern arbeite. Bei diesem Prozess haben wir uns auch ein bisschen kennen gelernt, und ich bin froh, dass wir uns jetzt in den Sozialen Medien gegenseitig folgen. Sollte ich jemals nach Ägypten kommen, besuche ich sie auf jeden Fall! Ich weiß natürlich, dass in jeder Übersetzung auch immer eine eigene Interpretation oder autobiografische Spuren der übersetzenden Person stecken. Und das finde ich gerade wunderbar und sehr reizvoll. Ich hätte so gerne die Übersetzung gelesen. Es muss fantastisch sein, den eigenen Text mit der Note einer anderen Person zu lesen.
Wie hat Ihr Vater reagiert, als er Ihre Übersetzung mit den Illustrationen Ihres Bruders Mehrdad in den Händen hielt?

Das war eine sehr verrückte Situation. Unser Vater wusste gar nicht, dass ich seine Autobiografie übersetze. Er hatte diesen Traum schon seit zehn Jahren aufgegeben. Wir hatten ihm gesagt, dass ich noch immer den Zeitreise-Roman schriebe und ihm nur deshalb diese vielen Fragen zu seinen Memoiren stellte. Alle haben mitgemacht, meine Geschwister, unsere Ehepartner*innen und die Enkelkinder. Es war sehr aufregend, ein Jahr lang stillzuhalten. An seinem 80. Geburtstag – einen Monat bevor die Pandemie unser aller Welt auf den Kopf stellte – trugen wir vier Kinder einen großen, schweren Karton mit 50 Exemplaren seiner Autobiografie an seinen Geburtstagstisch. Er packte aus und nahm eines der Bücher in die Hand. Mit seinem scharfen Chirurgenblick erspähte er sofort seinen eigenen Namen auf dem Buchcover. Natürlich wusste er, dass die Illustrationen von Mehrdad sind. Er und unsere Mutter fingen an, das Buch durchzublättern, und sahen die vielen Zeitzeugenfotos aus ihren Fotoalben, die meine Geschwister heimlich in wochenlanger Arbeit gesichtet und eingescannt hatten. Unsere Eltern schüttelten nur den Kopf und standen unter Schock. Sie waren sprachlos. Sie sagten immer wieder: „Ist das denn die Möglichkeit?“ Sie brauchten Wochen, um zu realisieren, was das bedeutete. Es war für uns alle und vor allem für die Enkelkinder ein unvergesslicher Moment.
Welche Rolle spielt das Übersetzen in Ihrem Leben und dem Ihrer Familie?
Für meine Geschwister und mich gehört das Übersetzen seit unserer Ankunft in Deutschland, also seit 35 Jahren, dazu, und wir konnten uns das nicht aussuchen. Es war einfach plötzlich da. Am Anfang war es ungewohnt und anstrengend. Doch im Laufe der Jahre verlor es die Schwere und die Trauer, die mit dem ungeheuren Abschied und dem Verlust einer Flucht zusammenhing. Es ist uns bewusst geworden, dass wir nicht nur Sprache übersetzen, sondern auch Kultur, Gefühle, Weltsichten und Wahrnehmungen. Wir haben verstanden, dass wir sehr reich sind, da wir in zwei Welten zuhause sind. Wir stehen immer mit einem Fuß auf einem Ufer und mit dem anderen Fuß auf einem anderen Ufer. So verbinden wir Morgen- und Abendland. Und das fühlt sich einfach nur gut an!