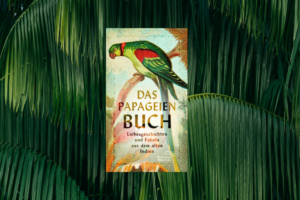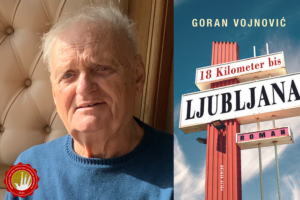Miyazawa Kenjis Ginga-tetsudō no yoru (銀河鉄道の夜) ist ein Schlüsseltext der japanischen (Kinder-)Literatur und Populärkultur. Erstmals 1934 veröffentlicht, ein Jahr nach dem Tod des Autors, hat sich die Geschichte über den einsamen Jungen Giovanni, seinen enigmatischen Freund Campanella und deren Reise durch die Milchstraßen-Galaxie tief in das kulturelle Gedächtnis Japans eingebrannt. Manga-Legende Matsumoto Leiji inspirierte Miyazawas Roman zur ikonischen Serie Galaxy Express 999 (銀河鉄道999), die Punk-Band Ging Nang Boyz besingt die „Nacht der galaktischen Eisenbahn“ in einem ihrer Lieder und Regisseur Miyazaki Hayao bewegte er zu seinem Meisterwerk Chihiros Reise ins Zauberland (千と千尋の神隠し). Nun erscheint der Roman unter dem Titel Eine Nacht in der Milchstraßenbahn erstmals in deutscher Sprache.
Der Cass-Verlag wirbt auf seiner Webseite mit dem Satz „Für Freunde des Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry“. Darin zeigt sich eine Vermarktungsstrategie, die nicht ausschließlich auf ein japaninteressiertes oder literarisches Publikum setzt, sondern versucht, im Kinderbuchmarkt Fuß zu fassen. Konzeptuell beeinflusst diese Entscheidung die gesamte deutsche Ausgabe, angefangen bei den Illustrationen, die diese zieren, bis zur Wahl der japanischen Textversion, die für die Übersetzung ausgewählt wurde. Eine Nacht in der Milchstraßenbahn unterscheidet sich bereits optisch von den meisten Ausgaben auf dem internationalen Markt. Unten sehen wir von links nach rechts das Buchcover der deutschen Ausgabe im Vergleich zu einer japanischen Taschenbuchausgabe, sowie die französische Übersetzung von Hélène Morita und die englische Übersetzung von Julianne Neville.




Ob dies aus dem Wunsch geschehen ist, Miyazawa Kenjis primär an Kinder gerichteten Werken treu zu bleiben oder ob hier die offenbar schwierige Vermarktbarkeit des Romans im deutschsprachigen Raum eine Rolle spielte, lässt sich nur vermuten.
Miyazawa Kenjis Ginga-tetsudō no yoru wurde seit 1984 mindestens neun Mal ins Englische übersetzt. In Frankreich liegen seit den 90er-Jahren ebenfalls mehrere Übersetzungen vor. Wieso dauerte es also fast 90 Jahre, bis dieser Roman nun erstmals in deutscher Sprache und gedruckt vorliegt? Vielleicht war ein japanischer Roman, dessen Protagonisten die Namen Giovanni und Campanella tragen, einfach nicht attraktiv für den deutschen Buchmarkt, der bei der Vermarktung japanischer Literatur leider immer noch häufig auf „Kirschblüten-Exotik“ und Japanklischees setzt.

Aber noch vor Eigennamen von Personen und Realien muss der Romantitel betrachtet werden: Ginga-tetsudō no yoru. Dieser lässt sich auf vielfache Weise übersetzen, was ein kurzer Überblick über einige englische und französische Varianten deutlich macht.
Englisch:
Night of the Milky Way Railroad (Stroud 1984)
Night Train to the Stars (Bester 1987)
Night of the Milky Way Railway (Strong 1991)
Night on the Galactic Railroad (Neville 2014)
Französisch:
Le train de la Voie lactée (Lecoeur 1990)
Train de nuit dans la Voie lactée (Morita 1995)
Der japanische Titel Ginga-tetsudō no yoru lässt sich wörtlich als „Die Nacht der galaktischen Eisenbahn“ oder „Eine Nacht in der galaktischen Eisenbahn“ übersetzen. In der deutschen Übersetzung wurde sich für letzteres entschieden, wodurch der Fokus auf die Protagonisten gelegt wird. Das Wort Milchstraße, das sich in vielen Titelübersetzungen findet, die vorliegende eingeschlossen, ist ein Sprachbild, welches es im Japanischen nicht gibt. Wenn also der Lehrer zu Beginn das „verschwommene Weiße, von dem man sagt, es sei Milch, es sei eine Straße“ beschreibt, dann ist dieses Sprachbild für das japanische Lesepublikum ein ungewohntes. Es ist nicht weniger ungewöhnlich als der auf Japanisch nur schwer auszusprechende Name Campanella (カムパネルラ). Der in Japan übliche Begriff ist Himmelsfluss (天の川). Keine der beiden Varianten findet sich aber im japanischen Titel wieder, da Miyazawa zwischen Himmelsfluss/Milchstraße (天の川) und Galaxie (銀河; wörtlich: Silberner Fluss) unterscheidet, was Sato Hiroaki in seiner Kritik einiger englischsprachiger Übersetzungen aus dem Jahr 1996 verwundert angemerkt hat. Mit Eine Nacht in der Milchstraßenbahn, eigentlich Milchstraßen-Eisenbahn, wurde vermutlich der kinderfreundlichere, weniger nach Science-Fiction klingende Titel ausgewählt.
Im Zentrum des Romans steht der Junge Giovanni, dessen Vater zur See gefahren ist und dessen Rückkehr von seiner Familie sehnlichst erwartet wird. Gerüchten zufolge sitzt dieser im Gefängnis. So muss Giovanni alleine für seine kranke Mutter und seine Schwester sorgen, indem er nach der Schule in einer Druckerei aushilft und Besorgungen für seine Familie macht. Dadurch wird er in der Schule zum Außenseiter. Einzig sein Sandkastenfreund Campanella hält noch zu ihm. Als Campanella auf eine Frage des Lehrers antworten soll, die Giovanni kurz zuvor nicht beantworten konnte, schweigt er, um seinen Freund nicht bloßzustellen.
それをカムパネルラが忘すれるはずもなかったのに、すぐに返事をしな かったのは、このごろぼくが、朝にも午後にも仕事しごとがつらく、学校に出てももうみんなともはきはき遊あそばず、カムパネルラともあんまり物を 言わないようになったので、カムパネルラがそれを知ってきのどくがってわざと返事をしなかったのだ、そう考えるとたまらないほど、じぶんもカムパネルラもあわれなような気がするのでした。
Das kann Campanella unmöglich vergessen haben, er hat dem Lehrer nicht sofort geantwortet, weil er weiß, dass ich morgens und nachmittags so viel zu tun habe und in der Schule sogar zu müde bin, um mit den anderen richtig zu spielen, selbst mit Campanella stecke ich ja kaum noch den Kopf zusammen, genau, er hat dem Lehrer absichtlich keine Antwort gegeben, weil ich ihm leid tue, dachte Giovanni und bedauerte den armen Campanella und sich selbst, so elend war ihm zumute.
Diese Stream of consciousness-artige Passage wirkt in der Übersetzung ebenso eindringlich und unvermittelt wie im Japanischen. Dabei gelingt es Stalph, Nuancen des japanischen Textes einzufangen, ohne dabei unnötig auszuschweifen oder den Fluss des Satzes zu stören. Im japanischen Satz wird Giovannis Erkenntnis (dass Campanella absichtlich keine Antwort gegeben hat) mit einem betonenden Satzendpartikel のだ (わざと返事をしなかったのだ) am Satzende signalisiert, was im Deutschen mit einem zwischengeschobenen „genau“ gelöst wird. Der Vergleich der Textlänge beider Sprachen zeugt ebenfalls von der Präzision der Übersetzung. Manchmal erscheint die deutsche Fassung dabei sogar noch etwas eleganter als der japanische Text.
線路のへりになったみじかい芝草の中に、月長石ででも刻まれたような、すばらしい紫のりんどうの花が咲いていました。
Auf der die Gleise säumenden Wiese blühte wie aus Mondstein geschnitten in schönem Purpur der Enzian.
Dies geschieht wohlgemerkt ohne inhaltliche Kürzungen oder willkürliche Verschönerungen des Herkunftstexts.
Für Leser*innen, die mit Ginga-tetsudō no yoru vertraut sind, mag der Begriff Kinderliteratur, oder Kindergeschichte (Dōwa 童話), den Miyazawa selbst verwendete, etwas befremdlich wirken. Schließlich bereitet das vielschichtige Textgewebe dieses fragmentarischen Romans der Literaturwissenschaft bis heute Kopfzerbrechen. Der Ausgangstext ist kein einfacher, durchdrungen von wissenschaftlichem und fantastisch-metaphysischem Vokabular, sowie Neologismen. Wenn also im Roman ganz beiläufig vom „dreidimensionalen Raum“ (三次空間) oder der „perfekt imaginierte[n] vierdimensionale[n] Milchstraßenbahn“ (不完全な幻想第四次の銀河鉄道) gesprochen wird, dann klingt das für japanische Leser*innen inhaltlich nicht weniger kryptisch als für deutsche. Diese stellenweise schwer zugängliche, experimentelle Prosa wird in der Übersetzung originalgetreu reproduziert. Besonders soll hier die Stelle erwähnt sein, in der Giovanni zu träumen beginnt und sich die Ankunft des galaktischen Zuges ankündigt:
そしてジョバンニはすぐうしろの天気転の柱がいつかぼんやりした三角標の形になって、しばらく蛍のように、ペカペカ消えたりともったりしているのを見ました。それはだんだんはっきりして、とうとうりんとうごかないようになり、濃い鋼青色のそらの野原にたちました。
Dann bemerkte Giovanni, dass der Turm hinter ihm sich zu einem erst nur undeutlich zu sehendem Dreieck verformte, zu einer Art Pyramide, und wie ein Glühwürmchen blinkte. Das Signaldreieck schälte sich immer deutlicher heraus, bis es schließlich, zum Stillstand gekommen, in den kobaltblauen Himmel ragte, geradewegs hin zu der wie eine Platte aus frisch gehärtetem blauen Stahl erscheinenden Himmelsebene.
Der Übersetzer Eric Margolis führt genau diese Textstelle auf, um für die „Unübersetzbarkeit“ von Miyazawas Roman zu plädieren. Dieser sei nämlich von lautmalerischen Ausdrücken durchzogen – ein alltäglicher Bestandteil der japanischen Sprache, auch der literarischen – ergänzt um zahlreiche Eigenkreationen des Autors. In der obigen Passage finden sich so zum Beispiel im Japanischen übliche Onomatopoetika wie „peka-peka“ ペカペカ für das Blinken des Signaldreiecks und „dan-dan“ だんだん, das allmähliche Sichtbarwerden jenes Dreiecks. Dann kommt das auf Miyazawa zurückgehende „tō-tō-rin“ とうとうりん als Bezeichnung für das zum Stillstand Kommen des Dreiecks. Ohne diese klangliche Dimension fehle dem Text laut Margolis etwas Essenzielles. Bei seiner Kritik lässt Margolis offen, ob eine „wörtliche“ Übersetzung mit „blink-blink an- und ausgehenden“ Lichtern diesen Sprachcharakter besser einfangen könnte.
Glücklicherweise erspart Stalph den deutschen Leser*innen etwaige Exotismen. Die sprachliche Übertragung ist hochpräzise. Besonders die Wahl des Verbs „schälen” zur Beschreibung des langsamen Prozesses, durch den das Signaldreieck in Giovannis Traum Gestalt annimmt, trifft hervorragend die surreale Ebene der Geschehnisse. Auch die wissenschaftliche Terminologie, die Miyazawa in seine Traumlandschaften einfließen lässt, fügt sich nahtlos im deutschen Text zu einer Einheit, so zum Beispiel, als Giovanni den Ausblick aus einem Fenster der Eisenbahn beschreibt:
けれどもだんだん気をつけて見ると、そのきれいな水は、ガラスよりも水素よりもすきとおって、ときどき眼のかげんか、ちらちら紫いろのこまかな波をたてたり、虹のようにぎらっと光ったりしながら、声もなくどんどん流れて行き、野原にはあっちにもこっちにも、燐光の三角標が、うつくしく立っていたのです。遠いものは小さく、近いものは大きく、遠いものは橙や黄いろではっきりし、近いものは青白く少しかすんで、あるいは三角形、あるいは四辺形、あるいは電や鎖の形、さまざまにならんで、野原いっぱいに光っているのでした。ジョバンニは、まるでどきどきして、頭をやけに振りました。するとほんとうに、そのきれいな野原じゅうの青や橙や、いろいろかがやく三角標も、てんでに息をつくように、ちらちらゆれたり顫えたりしました。
Als er aber achtsamer hinschaute, sah er das Wasser dahinfließen, lautlos, transparenter als Glas und sogar Wasserstoff, manchmal sich purpurn kräuselnd, manchmal irisierend wie ein Regenbogen, und überall in der Ebene standen schön phosphoreszierende Signaldreiecke. Alles glänzte und funkelte, Entferntes klein, orange und gelb, Nahes groß und bläulich verschwommen, Dreiecke, Vierecke, Verkettetes und Gezacktes. Giovanni klopfte das Herz bis zum Hals, ungläubig schüttelte er den Kopf. Alles in der Ebene, das Blau und das Orange und die schillernden Signaldreiecke, alles wogte und zitterte, als ob es atmete.
Scheinbar mühelos fügen sich diese dicht geschilderten Eindrücke zu einem Textfluss zusammen, der sich nicht mehr oder weniger abstrakt liest als im Japanischen. Stalph bedient sich dabei kleiner Kunstgriffe, um die Bildgewalt des japanischen Textes im Deutschen zu erhalten, ohne die Übersetzung dadurch wirr oder sperrig wirken zu lassen. So finden sich in der obigen Passage einige Umstellungen. Im mittleren Satz wird die Erwähnung der Ebene (野原) gestrichen, auf der „alles glänzte und funkelte“, um eine dreifache Wiederholung des Wortes zu vermeiden. Wiederholungen dieser Art fallen im Japanischen nicht störend auf, im Deutschen hingegen schon. Zudem wird die Struktur des Satzes aufgebrochen. Statt wie im Japanischen zwischen Ferne und Nähe hin- und herzuwechseln, werden die Eindrücke gesammelt hinter „Entferntes“ („klein, orange und gelb“) und „Nahes“ („groß und bläulich verschwommen“) aufgelistet. Blitzartige und kettenartige Formen finden sich als Verkettetes und Gezacktes wieder. Kein unnötiger Ballast, keine unnatürlichen Überbleibsel des Japanischen stören den Lesefluss der Übersetzung, was bei Anbetracht des hochkomplexen Ausgangstextes eine beachtliche Leistung ist.
Dennoch löste meine erste Lektüre der deutschen Übersetzung Verwunderung, sogar Verwirrung bei mir aus. Ich fand im deutschen Text Stellen, an die ich mich auch nach zweifacher Lektüre des japanischen Textes nicht erinnern konnte. Nach einiger Recherche (die mehr Zeit in Anspruch nahm als die Lektüre der Übersetzung), fand ich heraus, dass die Veröffentlichungsgeschichte von Ginga-tetsudō no yoru noch komplizierter ist, als ich anfangs angenommen hatte. Für eine Übersicht verweise ich der Einfachheit halber auf Jon Holts Arbeit Ticket to Salvation Nichiren Buddhism in Miyazawa Kenji’s Ginga tetsudō no yoru (2014).
Jedenfalls musste ich feststellen, dass es sich bei der mir vorliegenden japanischen Ausgabe des Romans, die ich 2019 in einem Tokyoter Buchladen gekauft hatte, um eine andere handelte als die, die für die deutsche Übersetzung verwendet wurde. Auf Nachfrage – eine Angabe der verwendeten Ausgabe fehlt in der deutschen Fassung – erfuhr ich vom Cass-Verlag, dass Eine Nacht in der Milchstraßenbahn auf einer Version aus Band 7 der Miyazawa-Gesamtausgabe (Chikuma Bunko) basiere. Jene Fassung enthält Textstellen, die im vierten und letzten Manuskript des Romans vom Autor selbst weggekürzt wurden. Es ist dieses vierte Manuskript, dass sowohl in Japan als auch durch die zahlreichen bisherigen Übersetzungen weltweit die größte Verbreitung gefunden hat. Kurz: Wer den Roman bereits auf Japanisch oder in einer anderen Sprache gelesen hat, der wird beim Lesen der deutschen Übersetzung wahrscheinlich ähnlich verwundert sein wie ich.
Das muss aber nicht von Nachteil sein, im Gegenteil. Viele dieser nachträglich wieder eingefügten Stellen helfen dabei, die Figuren besser zu charakterisieren und die stellenweise surreale Handlung kohärenter und verständlicher zu machen. So wird beispielsweise beschrieben, wie Giovanni vor den anderen Jungen zum Wetterturm flieht, als diese ihn wieder aufziehen.
(ぼくはどこへもあそびに行くところがない。ぼくはみんなから、まるで狐のやうに見えるんだ。
ジョバンニは橋の上でとまって、ちょっとの間、せ はしい息できれぎれに口笛を吹きながら泣き出したいのをごまかして立ってゐましたが、にはかにまたちからいっぱい走りだしました
›Mit mir will keiner was zu tun haben. Als ob ich die Krätze hätte.‹
Auf der Brücke hielt Giovanni eine Weile inne und pfiff, weil ihm sonst die Tränen gekommen wären, um Atem ringend ein Lied. Dann rannte er so schnell er konnte wieder los, den schwarzen Hügel hinan.
Es sind nur wenige Sätze, die aber bei der Charakterisierung Giovannis helfen und den Schmerz des vereinsamten Jungen in Form eines Tränenausbruchs explizit machen. Die bedeutendste Stelle, die im vierten Manuskript von Miyazawa Kenji entfernt wurde, ist der Auftritt von Professor Bulcaniro (ブルカニロ博士), der in der deutschen Übersetzung als Mann mit der Cello-Stimme in Erscheinung tritt. Dieser erklärt Giovanni, bevor er von seiner traumhaften Reise erwacht, nicht weniger als die Geschichte des Universums:
だからこの頁一つが一冊の地歴の本にあたるんだ。いいかい、そしてこの中に書いてあることは紀元前二千二百年ころにはたいてい本当だ。さがすと証拠もぞくぞく出ている。けれどもそれが少しどうかなとこう考えだしてごらん、そら、それは次の頁だよ。
紀元前一千年。だいぶ、地理も歴史も変わってるだろう。このときにはこうなのだ。変な顔をしてはいけな い。ぼくたちはぼくたちのからだだって考えだって、天の川だって汽車だって歴史だって、ただそう感じているのなんだから、そらごらん、ぼくといっしょにすこしこころもちをしずかにしてごらん。いいか
Eine Seite dieses Buches entspricht deshalb einem ganzen Buch der Erdgeschichte. Was hier steht, trifft im Großen und Ganzen zu. So stellte man sich die Welt um das Jahr 2200 vor Christus vor. Das lässt sich leicht beweisen. Wenn du denkst, das kann doch nicht sein, dann schau dir die nächste Seite an, hier. 1000 vor Christus. Da sah es so aus. Ganz anders, nicht wahr? Das muss dich aber nicht verwundern. Unser Körper, unser Denken, die Milchstraße, der Zug, die Geschichte – das alles ist so, weil wir es uns so vorstellen. Und jetzt, pass auf, wollen wir eine Weile in uns gehen. Bereit?
Diese Begegnung nimmt knapp vier Seiten in der Übersetzung ein, fehlt aber im vierten Manuskript und in den meisten darauf basierenden Übersetzungen gänzlich. Miyazawa entfernte immer wieder Stellen, vermutlich um seinen Roman abstrakter zu machen. Wie ich während der Recherche zu diesem Artikel erfahren habe, gibt es nicht wenige japanische Leser*innen, die diese Passage, ursprünglich aus dem dritten Manuskript, noch nie gelesen haben.
Für die erste deutsche Übersetzung des Texts scheint die Auswahl dieser erweiterten japanischen Ausgabe in zweifacher Hinsicht vorteilhaft: Zum einen bringt sie – neben der Qualität der deutschen Übersetzung – einen gewissen Mehrwert, da viele Leser*innen nun erstmals die oben zitierte „Aufwachszene“ sowie weitere später ausgelassene Textstellen zum ersten Mal erleben können. Zum anderen ist das Ergebnis ein kohärenter Text, der auf ein Nachwort, Fußnoten oder Vermerke zu Auslassungen im Manuskript verzichten kann.

Bei der Präsentation des Buches darf die Rolle der Illustrationen nicht unerwähnt bleiben. Diese wurden kunstvoll von Louise Heymans angefertigt. Neben den ganzseitigen Illustrationen finden sich auch einige kleinere Darstellungen von Gegenständen aus der Handlung, zum Beispiel von Giovannis Fahrschein. Bei Heymans Illustrationen stehen Giovanni, dessen Gefühlswelt und das Abenteuer im Vordergrund. Die tragischen Ereignisse, die innerhalb der Geschichte erzählt werden, sowie die religiöse, vor allem christliche Symbolik, die in japanischen Bildbänden zum Roman oft, vermutlich auch aufgrund ihres „exotischen“ Charakters, eine zentrale Rolle spielt, wird hier verständlicherweise außen vorgelassen.
Die von Blautönen geprägten Illustrationen folgen dabei der Tradition japanischer Bildinterpretationen des Romans. Die ausgeprägte Kinderbuchästhetik des Bandes hebt sich jedoch von den meisten japanischen und internationalen Ausgaben ab, deren Cover oft einen Spagat zwischen märchenhaft-fantastischen und abstrakt-surrealen Elementen darstellen. So wird die deutsche Ausgabe sicherlich zum Blickfänger in jeder Kinderbuchabteilung.
Jürgen Stalphs Übersetzung gelingt es, die Magie dieses sprachlich äußerst komplexen „Kinder“-Romans ins Deutsche zu übertragen. Der Text bleibt da obskur und rätselhaft, wo er es auch im Japanischen ist, wird dabei aber nie sperrig oder unverständlich. Erstleser*innen wird ermöglicht, dieser fantastischen Reise ohne Vorkenntnisse beizuwohnen. Und wer den Text bereits in anderen Sprachen gelesen hat, kann sich höchstwahrscheinlich auf einige „neue“ Entdeckungen freuen, nämlich auf Textstellen, die im weit verbreiteten vierten Manuskript des Romans nicht enthalten sind. Nun muss sich nur noch zeigen, ob sich die Vermarkungsstrategie des Cass-Verlags als Erfolg erweist und die Zurückhaltung der anderen Verlage, den Text nach Deutschland zu bringen, als Fehler straft. Zu wünschen wäre es allemal.
Alle japanischen Zitate entstammen den folgenden zwei Manuskripten:
Viertes Manuskript und Aufwachszene: Miyazawa Kenji (1969). Ginga-tetsudō no yoru. Kadokawa Bunko.
Drittes Manuskript: Miyazawa Kenji (1951). Ginga-tetsudō no yoru. Iwanami Bunko.