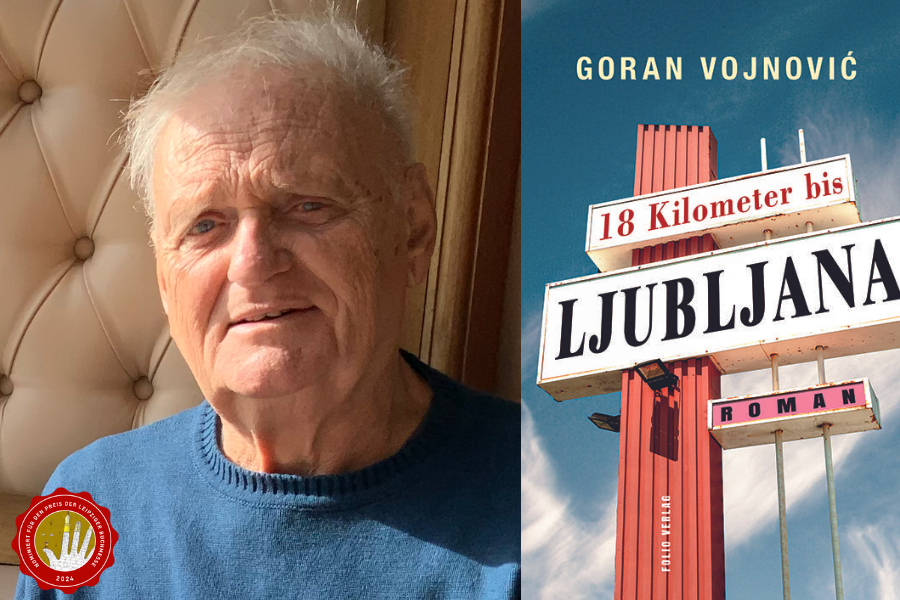Das Grab der englischen Dichterin Aphra Behn befinde sich, schreibt niemand Geringeres als Virginia Woolf in ihrem Essay Ein Zimmer für sich allein, „skandalöserweise, aber aus guten Gründen in der Westminster Abbey“. Skandalöserweise, weil Behn entgegen jeglicher gesellschaftlichen Erwartungen zeitlebens eine erfolgreiche Dichterin war, die mit ihrem Schreiben ihr eigenes Geld verdiente. Skandalöserweise aber auch, weil sie politische, erotische und somit für eine Frau skandalöse Verse geschrieben hatte, die manche nachfolgenden Generationen als anstößig empfanden.
Oft heißt es nun über Aphra Behn, die vermutlich 1689 in London starb, sie sei eine in Vergessenheit geratene Dichterin, die in den letzten Jahrzehnten im Zuge der feministischen Aufarbeitung der englischsprachigen Literaturgeschichte wiederentdeckt wurde. Tatsächlich ist unbestreitbar, dass ihr Werk dank dieser Aufarbeitung (und der lobenden Worte einer Virginia Woolf) heute anders bewertet wird als in anderen Jahrhunderten. Galt sie vor allem im viktorianischen Zeitalter als fragwürdige Autorin, die im London der Stuart-Restauration unzählige Gedichte und Dramen geschrieben hatte, denen es angeblich an literarischer Qualität mangelte, wird sie heutzutage als Englands erste Berufsschriftstellerin gesehen, die den großen englischsprachigen Schriftstellerinnen des 18. und 19. Jahrhunderts den Weg bahnte. Der Platz im Kanon der englischsprachigen Literatur ist ihr inzwischen sicher.
Und dennoch tut man Aphra Behn Unrecht, wenn man sie als eine „in Vergessenheit“ geratene Dichterin bezeichnet, die erst aus der Obskurität gerettet werden musste. Behn war schon zu Lebzeiten überaus bekannt und schrieb unter dem Pseudonym Astrea ein Dramenstück nach dem anderen. Auch unzählige Gedichte und einige Prosatexte gehören zu ihrem Werk. Nicht zuletzt hat sie übrigens auch übersetzt, vorrangig aus dem Französischen, darunter Fontenelles Histoire des Oracles. Sie war eine überaus produktive Dichterin, auch weil sie damit ihren Lebensunterhalt sicherte und aufgrund ihres ausschweifenden Lebensstils oft einige Schulden zu begleichen hatte.
Ihre ungewöhnliche Biografie zeichnet das Bild einer extravaganten, ehrgeizigen Frau. Sie galt als attraktiv, war lediglich kurz verheiratet (ihr Ehemann starb wohl nach der Hochzeit) und stürzte sich mit Anfang dreißig in das Londoner Leben, ihren Namen kannte man am Hof von Karl II. Zuvor hatte sie den Geschichten zufolge in einer damals englischen Kolonie in Südamerika gelebt, war als Spionin für das englische Königshaus nach Antwerpen gegangen und hatte nicht zuletzt auch einige Zeit im Gefängnis verbracht, der Grund waren auch hier wohl einige unbezahlte Schulden. Männliche Zeitgenossen irritierte ihre Schriftstellerei, daher versuchten sie Behn hin und wieder zu diffamieren. Diese antwortete unbeirrt in messerscharfen, wenig subtilen Versen, die sie ihre Schauspieler auf der Bühne vortragen ließ:

Geist und Klugheit folgen wir gern,
Aber den törichten und hirnlosen Herrn
Beweisen wir hier, dass wir, nebst andrem sonst,
Euch kopieren mit beachtlicher Kunst:
Und wenn ihr das Theater liebt, sagt an,
Warum sollte eine Frau nicht so gut schreiben wie ein Mann?
Ihr heutzutage bekanntestes Werk ist Oroonoko oder Der königliche Sklave (1688), eine Erzählung, die im Zuge der postkolonialen Auseinandersetzung mit Literatur neuerdings wieder an Relevanz gewann, aber auch in formaler Hinsicht interessant ist. Der Prosatext wird als Vorläufer, wenn nicht sogar als einer der ersten englischen Romane überhaupt gesehen (Defoes Robinson Crusoe, ein Meilenstein in der Geschichte des englischen Romans, erschien erst 1719). Der Roman erzählt die Geschichte der Titelfigur, Oroonoko, dessen Großvater der König von Coramantien (dem heutigen Ghana) ist. Oroonoko wird als edler, nach europäischem Vorbild ausgebildeter junger Prinz beschrieben, der sich unsterblich in die schöne Imoinda verliebt. Doch sein eifersüchtiger Großvater macht ihm Konkurrenz und führt Imoinda in seinen Besitz über.
Als der Großvater die beiden beim Liebesspiel entdeckt, verkauft er zum Unglück Oroonokos die junge Imoinda an einen Sklavenhändler. Später gerät Oroonoko zusammen mit seiner Belegschaft in einen Hinterhalt und wird selbst als Sklave nach Surinam gebracht. Dort verkauft man ihn an den Sklavenhalter Tefry, auf dessen Land er schließlich Imoinda wieder trifft. Als diese schwanger wird, verlangt Oroonoko seine Freiheit, um in sein Heimatland zurückzukehren. Frustriert von den leeren Versprechungen des Gouverneurs organisiert er schließlich eine Revolte – die ein äußerst blutiges Ende nimmt.
Behn schrieb den Text nicht zur Hochzeit ihres literarischen Schaffens, sondern erst gegen Ende ihres Lebens. Womöglich blickte sie mit der Erzählung auf ihre eigenen Erfahrungen in Surinam zurück, das damals kurzzeitig eine englische Kolonie war, die später gänzlich an die Niederlande abgetreten wurde und erst 1975 ihre Unabhängigkeit erlangte. Es wird davon ausgegangen, obgleich die Faktenlage recht dünn ist, dass Behn zusammen mit ihren Eltern (der Vater verstarb wohl auf der Überfahrt) und ihrem Bruder in die Kolonie reiste. Über das Leben der Familie vor Ort ist wenig bekannt, und einige bezweifeln noch immer, dass Behn tatsächlich in Surinam gewesen war, obgleich der Text durchzogen ist von detaillierten Beschreibungen der Umgebung und es tatsächlich belegt ist, dass es in der benannten Region einige Sklavenaufstände gab.
Oroonoko galt im 17. Jahrhundert als Erfolg und erschien in immer neuen Ausführungen. Eine Bühnenfassung von Thomas Southerne sorgte dafür, dass die Geschichte auf den Londoner Bühnen und bis ins 18. Jahrhundert hinein verbreitet wurde. Es folgten auch Übersetzungen ins Deutsche und ins Französische. Die Erzählung über das Schicksal des außergewöhnlichen Sklavens war gewissermaßen konkurrenzlos, da es bis dato kaum bekannte Autoren gab, die sich dem Thema der Sklaverei so explizit angenommen hatten. Die Kritik an dem brutalen Umgang mit Oroonoko, die sich in dem Werk findet, wurde später auch im Zuge des Abolitionismus aufgegriffen. Dennoch wäre es zu einfach, Behn als große Gegnerin der Sklaverei und Befürworterin ihrer Abschaffung zu stilisieren. Vor allem die Rolle der weiblichen Erzählerin (die gern mit Aphra Behn selbst verwechselt wird), die sowohl das Geschehen beobachtet als auch im Nachgang darüber berichtet, wirft seit jeher Fragen auf. Die Erzählung schwankt zudem zwischen der Heroisierung des Heldens und einer recht oberflächlichen Figurenzeichnung sowie Darstellungen massiver Gewaltbereitschaft aufseiten der Kolonialherren und aufseiten der Sklaven. Kurzum: Behn schuf Raum für verschiedene Lesarten und damit gute Literatur.
Auch im 20. Jahrhundert wurde Oroonoko ins Deutsche übertragen. Es gibt eine ältere Übersetzung von Christine Hoeppener, die im Insel Verlag erstmalig 1966 erschien. 1995 veröffentlichte zudem der dtv Verlag eine Neuübersetzung in ihrer dtv-klassik-Reihe. Diese Neuübersetzung stammt von Susanne Althoetmar-Smarczyk, die nun zusammen mit Susanne Höbel die Übersetzung für den Unionsverlag überarbeitet hat. Dass Oroonoko angesichts der andauernden Diskurse über postkoloniale Literatur sowie der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte aufgrund seiner andauernden Relevanz wieder aufgelegt wird, überrascht nicht. Der Unionsverlag bettet die nur rund 100-Seiten lange Erzählung in eine Reihe von Essays ein, darunter ein längerer Text von Vita Sackville-West, die ihre Freundin Virginia Woolf wohl erst auf Aphra Behn aufmerksam gemacht hat, und zwei wissenschaftliche Heranführungen von Angeline Goreau und Laura Brown, die verschiedene Interpretationen der Erzählung anschneiden.
Oroonoko oder Der königliche Sklave ist eine Erzählung, die im 21. Jahrhundert aufgrund ihrer Brisanz und ihrer komplexen Gestaltung der kritischen Auseinandersetzung mit der Sklaverei auf der einen Seite und für ihre Zeit typischen Rassismen auf der anderen Seite wohl kaum einfach herunter übersetzt werden kann und ohne Kontextualisierung erscheinen sollte. Die Übersetzung wirft genau die Fragen auf, die in den vergangenen Monaten einige der Veranstaltungen zu übersetzerischen Themen dominierten: Wie finden Übersetzer:innen eine Sprache, die dem Original gerecht wird, ohne dem Text eigene, beispielsweise rassistische Sentiments überzustülpen? Wie findet man eine Sprache, die dem Zeitgeist gerecht wird, ohne den Originaltext zu glätten? Wie geht man bedacht mit politisch sensiblen Begriffen um, ohne die Wirkungsäquivalenz zu vernachlässigen?
Ein vergleichender Blick in die Neuauflage und die vorherigen Fassungen zeigt, wie sich die Herangehensweise an die Übersetzung von Oroonoko mit der Zeit geändert hat. Tatsächlich verrät der Vergleich unter Umständen mehr über die Zeit, in der die Übersetzerinnen leben als über die Zeit, in der der Text geschrieben wurde. Die folgende Beschreibung findet sich zu Beginn der Erzählung und führt die Leser:innen in den Sklavenhandel in Coramantien ein:
Am offensichtlichsten ist die Streichung des N‑Worts in der vom Unionsverlag neu aufgelegten Fassung, das in den vorherigen Übersetzungen noch zu finden ist. Die überarbeitete Übersetzung enthält leider kein Nachwort ihrer Übersetzerinnen, aber wir können davon ausgehen, dass der Auftrag bestand, den gesamten Text mit Blick auf Übersetzung sensibler Begriffe hin zu aktualisieren. Tatsächlich ist im Original abwechselnd von „Negroes“ und „Blacks“ die Rede, im englischen Sprachgebrauch noch immer gängige Begriffe, obgleich sie heutzutage ganz anders verwendet werden. Im Prinzip handelt es sich bei der Streichung des Worts in diesem Absatz eher um einen editorischen Handgriff, denn modernen Leser:innen stellt sich womöglich die Frage, warum es überhaupt die Ergänzung „black slaves altogether“ braucht. Wir halten also fest, dass die neueste Übersetzung mit Blick auf die Beschreibung der erwähnten People of Colour in dem Buch aktualisiert wurde.
Auffallend sind aber auch noch zwei weitere Unterschiede, die vor allem der Vergleich zwischen der Hoeppener-Übersetzung und der späteren Übersetzung vor Augen führt. Nach Coramantien „fahren die meisten unserer Großhändler, um diese Ware zu kaufen“, heißt es dort. Mit „Ware“ können eigentlich nur die Sklaven gemeint sein, mit denen hier Menschenhandel betrieben wird. Ein Blick auf den Originaltext zeigt, dass Behn die Menschen vor Ort nicht als Produkte bezeichnet, sondern von „that merchandise“, also dem Handel spricht. Auch in der späteren Übersetzung ist von „Ware“ als Bezeichnung für die veräußerten Sklaven nicht die Rede. Es handelt sich bei dieser Bezeichnung nicht um eine vom Ausgangstext vorgegebene Beschreibung, sondern um eine übersetzerische Interpretation.
Ähnlich auffallend ist aber auch das Ende dieses Zitats. Dort tauchen in der Übersetzung von Christine Hoeppener auf einmal die „Farbigen“ auf, eine recht freie und eigenwillige Übersetzung für den Beisatz „beauties that can charm of that colour“, der in der Neufassung als „Schönheiten dieser Hautfarbe“ übersetzt wurde. Letztere ist sicherlich nicht nur die originaltreuere, sondern auch passendere Übersetzung, weil sie die rassistischen Untertöne, die sich in der Erzählung durchaus wiederfinden, weder verstärkt noch übertönt. Die Verwendung von „Farbigen“, einem Begriff, der inzwischen als kolonialistisch eingestuft wird und negative Konnotationen hat, ist heutzutage umstritten bzw. wird von People of Colour abgelehnt. Die Verwendung des Begriffs in der älteren Übersetzung zeigt, wie Rassismen auf einen Text projiziert werden können. Man könnte sicherlich argumentieren, dass der Begriff der „Farbigen“ vor gut fünfzig Jahren als akzeptabel galt, aber es gibt noch andere Stellen, die deutlich machen, dass rassistische Stereotype in der Übersetzung verstärkt wurden.
Eine der wohl umstrittensten Szenen ist die äußerliche Beschreibung der Titelfigur Oroonoko. Tatsächlich bedient die Beschreibung Oroonokos (aber auch die Beschreibung der indigenen Bevölkerung in Surinam) das Klischee des „Edlen Wilden“, das auch in nachfolgenden Jahrhunderten immer wieder in der englischsprachigen Literatur zu finden ist. (Tatsächlich tritt der „noble savage“ nur wenige Jahre nach Erscheinen Oroonokos in John Drydens Drama The Conquest of Granada auf, wo der Begriff nachweislich zum ersten Mal im Englischen verwendet wurde.) Oroonoko wird als klassischer Held charakterisiert und damit entsprechend seiner Funktion in der Geschichte überzeichnet dargestellt. Im Text heißt es, er spreche mehrere Sprachen fließend, er habe durch den Kontakt zu einem französischen Gelehrten einen hohen Bildungsstand gemäß europäischem Vorbild und auch sein Äußeres lasse wenig zu wünschen übrig:
In der älteren Übersetzung von Christine Hoeppener finden sich im gesamten Text hin und wieder schöne, anschauliche Formulierungen („ihr weiß glich […] frischgefallenem Schnee“), aber der Vergleich mit dem Original und der Neuübersetzung macht deutlich, wie sehr Übersetzungen eben nicht in einem zeitlichen Vakuum entstehen, sondern von Menschen gemacht werden, die einer Übersetzung – ob nun bewusst oder unbewusst – ihre eigenen Interpretationen des Ausgangstextes und ihre eigenen Weltanschauungen mitgeben. Auf diese Weise wird im Satz „His eyes were the most awful that could be seen“ der Begriff “awful” bei Hoeppener zu „unerhört groß“, während in der neuesten Ausgabe das Wort viel näher an seiner früheren Bedeutung („worthy of respect or fear, striking with awe“) mit „fraglos Ehrfurcht gebietend“ übersetzt wird.
Ähnlich verhält es sich mit der Beschreibung der Nase, die Hoeppener mit „Er hatte die vorspringende Nase der Römer, nicht die platte der Neger“ übersetzt hat. Durch die Einfügung des Begriffs, der sich so im Original an dieser Stelle überhaupt nicht findet, verstärkt sie die abschätzige Bewertung der äußerlichen Charakteristika, die von der Erzählstimme im Original als typisch für die „afrikanische“ Bevölkerung gesehen werden. Vermutlich war dabei ihre Absicht, die Unterschiede zwischen Oroonoko, der eben kein „normaler“ Schwarzer Sklave ist, und den anderen Sklaven zu betonen, um den Helden für weiße Leser:innen in ein vermeintlich positiveres Licht zu rücken. Man könnte argumentieren, dass sie vorhatte, der Strategie der Autorin zu folgen (die sich wiederum nicht so leicht herausarbeiten lässt), aber der Sprung von „flat and African“ zu „die platte [Nase] der Neger“ ist groß.
Noch deutlicher werden die gravierenden Unterschiede dieser Übersetzungen mit Blick auf die Beschreibung der Mundpartie. „[The] finest shaped that could be seen, far from those great turned lips, which are so natural to the rest of the Negroes“ heißt es da im Originaltext, in dem ganz deutlich betont wird, wie sich Oroonoko (zu seinem Vorteil, suggeriert der Text) optisch abhebt. Die „great turned lips“ lassen Spielraum für Interpretation und auch eine Recherche ist in der Hinsicht unbefriedigend, so dass man aber zu dem Schluss kommen kann, dass es sich nicht für eine stereotype Redewendung für die Beschreibung von People of Colour handelt. Der Originaltext arbeitet mit vielerlei Widersprüchen, auch was die Charakterisierung der „Anderen“ angeht – auf der einen Seite ist Oroonoko schöner als „most of that nation“, auf der anderen Seite finden sich in dem Text wohlwollend gemeinte Beschreibungen der Schönheit der indigenen Bevölkerung. Im Vergleich ist die Übersetzung mit „dicken Wulstlippen“ nicht nur viel offensiver rassistisch, sondern lässt die Beschreibung gänzlich karikaturhaft wirken. Interessanterweise wurde diese Stelle auch im Zuge der Überarbeitung der Übersetzung von Susanne Althoetmar-Smarczyk subtil entschärft, von „dick“ zu „voll“ und „angeboren“ zu „eigen“.
Der Vergleich dieser Passagen zeigt nicht nur, wie unterschiedlich Texte in den Händen verschiedener Übersetzerinnen übersetzt werden, sondern auch wie unterschiedlich in verschiedenen Jahrzehnten übersetzt wird. Übersetzungen sind nicht zeitlos – sie sind im Gegenteil genau wie das Original ein Produkt ihrer Zeit. Aus diesem Grund ist beispielsweise in der Neufassung von Oroonoko auch das Wort „Rasse“ als Eins-zu-Eins-Übersetzung für „race“ getilgt worden, weil beide Begriffe eine ganz andere geschichtliche Bedeutung mitsichbringen und das eine im Englischen eben nicht einfach für das andere im Deutschen steht. Der vergleichende Blick in die verschiedenen Übersetzungen eines solchen Ausgangstextes zeigt, warum es der postkolonialen Debatten um die Deutungshoheit und die Dekonstruktion des kolonialen Blicks bedarf.
Nun steht noch immer die Frage im Raum: Ist die überarbeitete Übersetzung, die nun eingebettet in drei Essays und ausgestattet mit Glossar und Zeittafel im Unionsverlag erschienen ist, besser als die bisherigen Fassungen? Da sich die Gesamtqualität nicht nur anhand der Übersetzung einiger Stellen bewerten lässt, an denen heutzutage hochkomplexe und kontroverse Begriffe vorkommen, schauen wir uns zum Abschluss noch eine Passage an, um weitere Eindrücke der Übersetzung zu gewinnen:
Die zitierte Passage zeigt eine andere Seite von Behns Erzählstil. Wann immer es um die großen Leidenschaften des Lebens geht, neigt die Erzählung zur Rührseligkeit, was aber für die Zeit ihrer Entstehung nicht untypisch war. Zudem baut Behn hier als die große Dramatikerin, die sie war, Spannung auf. Die Liebe zwischen Oroonoko und Imoinda wird intensiv geschildert, damit sich die Tragik der nachfolgenden Ereignisse (erst die Trennung, dann die Versklavung, zuletzt Imoindas Tod durch Oroonokos Hand) entfalten werden kann. Die Neuübersetzung gibt sich dem Kitsch des Originals hin, ohne auf zu staubige Wörter wie „Holdseligkeit“ zurückzugreifen, um den Text künstlich älter wirken zu lassen. Zudem trifft sie das richtige Maß zwischen Imitation auf der einen Seite („seufzte und schluchzte und an Oroonoko dachte“) und der Loslösung vom englischen Original auf der anderen Seite: Der Satz endet dort nach „dachte“, bei Hoeppener geht der Satz noch weiter, was wenig zum Leseverständnis beiträgt.
Trotzdem können solche Stellen das eklatante Problem der überarbeiteten Übersetzung durch Susanne Althoetmar-Smarczyk und Susanne Höbel nicht überschatten. Dieses besteht vor allem darin, dass zwar die Übersetzung hinsichtlich einiger Begriffe aktualisiert, aber insgesamt keine durchgängig ersichtliche und schlüssige Strategie im Umgang mit sensiblen Begriffen verfolgt wurde: Warum wurde das N‑Wort zwar aus der Übersetzung der Erzählung komplett gestrichen, aber nicht aus dem ebenfalls neuübersetzten Essay von Vita Sackville-West, in dem es in direkten Zitaten vorkommt? (Falls diese nicht neu übersetzt worden sind, fehlt die entsprechende Anmerkung.) Und warum wurden einige Begriffe komplett gestrichen, aber das heutzutage ebenfalls problematische Wort „Indianer“ kommentarlos überall stehen gelassen? Behn verwendet im Original zwar den Begriff „Indians“, um die indigene Bevölkerung zu beschreiben, aber kann man diesen tatsächlich wörtlich mit „Indianer“ übersetzen, einem Begriff, der im Deutschen eine eigene Geschichte und Ikonografie mitsichzieht?
Die Bedeutung der Übersetzung solcher Begriffe ist im Falle von Aphra Behns Werk entscheidend, weil es sich um einen Text handelt, der einerseits zentral ist für die literarische Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte, weil er ganz offensichtlich Sklaverei, Kolonialismus und Rassismus thematisiert. Andererseits ist der Text selbst eben auch ein Produkt des Kolonialismus. In diesem Sinne ist nicht allein die Frage nach einem zwangsläufig politisch korrekten, sondern vor allem nach einem eflektierten Umgang mit der Sprache des Originals ausschlaggebend.
Dieser Umgang lässt in der neu aufgelegten Ausgabe aufgrund mangelnder Transparenz zu wünschen übrig. Ja, man hat die Übersetzung hinsichtlich solcher Begriffe überarbeitet, mit Sicherheit um primär zu gewährleisten, dass die Übersetzung nicht den Fehler begeht, Rassismen oder Stereotype zu verstärken, wie es in der alten Fassung von Christine Hoeppener der Fall war. Aber mit welchem Ziel wurden hier einzelne Begriffe einfach ausgetauscht und andere stehen gelassen? Die dtv-Klassik-Ausgabe enthält zwar ein Nachwort der Übersetzerin Susanne Althoetmar-Smarczyk, in dem wird die Übersetzung aber in keinster Weise erwähnt (was leider allzu oft vorkommt). Auch in der mit Susanne Höbel überarbeiteten Fassung fehlen die Kommentare der Übersetzerinnen, obwohl es in der Ausgabe drei zusätzliche Essays zu lesen gibt. Wir erfahren somit viel über Behn und ihr bewegtes Leben, aber nichts über die Übersetzung dieses monumentalen Werks. Schade.