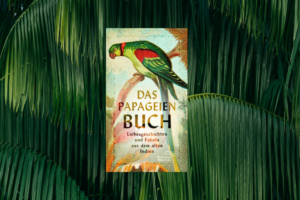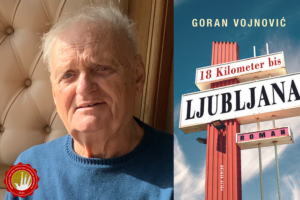Im Laufe der Literaturgeschichte wurde so viel über das Leben der Brontë-Schwestern geschrieben, dass die drei Frauen inzwischen eher mythischen Figuren als echten Menschen gleichen, die vor über 150 Jahren gelebt haben sollen. Der Legende nach wuchsen die Schwestern Charlotte, Emily und Anne gemeinsam mit ihrem Bruder Branwell mutterlos in einem abgeschiedenen Örtchen im Norden Englands auf. Der Legende nach überschattete das unstete Leben des talentierten, aber doch unberechenbaren Bruders das Wirken seiner nicht weniger talentierten Schwestern, die trotz der strengen Fuchtel des Vaters und dem alles an sich reißenden Bruder schöpferisch tätig waren. Der Legende nach hat vor allem das mittlere Kind – Emily – das väterliche Pfarrhaus, gelegen in dem unscheinbaren Haworth, nur ungern verlassen. Lieber verbrachte sie ihre Zeit in fast völliger Isolation, höchstens in Anwesenheit ihrer vierbeinigen Freunde, bis sie mit knapp 30 Jahren frühzeitig an Tuberkulose starb.
Wie konnten unter solchen Umständen zwei der beliebtesten und bedeutendsten englischsprachigen Romane des 19. Jahrhunderts – Charlotte Brontës Jane Eyre und Emily Brontës Sturmhöhe – entstehen? (Man könnte an dieser Stelle auch Anne Brontës nicht weniger radikales Werk Die Herrin von Wildfell Hall hinzuzählen, das leider immer noch unterschätzt wird.) Diese Frage gibt noch immer einige Rätsel auf, doch je mehr man über die Schwestern und ihr kurzes Schaffen liest, desto weniger greifbar scheinen die Schwestern zu werden, denen noch immer gänzlich unterschiedliche Charaktere zugeschrieben werden und deren Leben wohl weniger abgeschieden verliefen, als lange Zeit berichtet wurde.
Wenn man eines aus ihren vielfach reproduzierten Biografien ziehen will, dann dass die Schwestern früh anfingen zu schreiben (es gibt unzählige jugendliche Erzeugnisse der Geschwister, von denen die Fantasy-Erzählung Gondal wohl die bekannteste ist) und ambitioniert wie auch strategisch vorgingen. Die Romane der Schwestern wurden an die wichtigsten Londoner Verlage geschickt, darunter auch Newby & Sons, der nach einigen Verhandlungen nicht nur Jane Eyre, sondern auch Sturmhöhe und Anne Brontës Agnes Grey 1847 zum Druck brachte.
Wie für weibliche Autoren damals nicht unüblich wurden die Romane unter den Pseudonymen Currer, Ellis und Acton Bell veröffentlicht. Mit der Namenswahl blieben die geschwisterlichen Bindungen erhalten, sie sorgten aber auch für hartnäckige Spekulationen, ob sich hinter den drei Pseudonymen nicht ein und dieselbe Person verberge. Jane Eyre war von den drei Romanen am erfolgreichsten, sodass Charlotte Brontë, die ihre vorzeitig, nacheinander verstorbenen Schwestern um einige Jahre überlebte, ihre Autorschaft enthüllte und bei ihrem Eintritt in die Londoner Gesellschaft mit recht offenen Armen empfangen wurde. Ihre Zeitgenossin, die ebenfalls in England verehrte Autorin Elizabeth Gaskell, schrieb mit The Life of Charlotte Brontë die erste Biografie über das Leben der Schwestern, die nur zwei Jahre nach Charlottes Tod erschien. Damit begann die Legendendichtung.

Manche mögen die Bücher der Brontë-Schwestern für überzogen, belanglos oder gar schlecht befinden: Ihr Platz im Kanon der englischsprachigen Literatur ist allerdings unumstritten und der Einfluss reicht bis ins 21. Jahrhundert. Ihr Heimatort Haworth, in dem sich noch immer das Haus der Familie befindet, ist zur Pilgerstätte unzähliger Fans (darunter auch Patti Smith) geworden. Es gibt unzählige Bücher, die auf die Romane der Brontë-Schwestern verweisen oder gar von diesen inspiriert wurden – von Jean Rhys Klassiker Die weite Sargassosee bis hin zu Stephenie Meyers Bis(s) zum Abendrot. Die Romane, vor allem Jane Eyre, wurden zudem so oft verfilmt, dass sich wohl aus jedem Jahrzehnt seit Beginn der Filmgeschichte eine Fassung finden lässt. Und dank Kate Bushs wegweisender, sirenenhafter Pop-Interpretation ist mit „Wuthering Heights“ ein Romantitel auch in die Annalen der Musikgeschichte eingegangen.
Emily Brontës Roman Sturmhöhe sticht innerhalb dieser beispiellosen Erfolgsgeschichte durchaus heraus – ihre Zeitgenoss:innen (allen voran die eigene Schwester Charlotte) wussten mit dem Roman, der sich weder in ein Genre pressen lässt noch den literarischen Konventionen seiner Zeit folgt, wohl wenig anzufangen. Trotzdem eilt Emily Brontë als vermeintlich „mysteriöseste“ der drei Schwestern noch bis heute ein gewisser Ruf voraus, der gleichermaßen fasziniert wie irritiert, und ähnliches lässt sich auch über ihren Roman sagen, der bis heute die Kritiker- und Leserschaft spaltet.
Sturmhöhe ist ein höchst origineller, aber anspruchsvoller Roman, dessen komplexe Erzählebenen zwar zu seiner ungewöhnlichen Geschichte passen, aber sicherlich schon so einigen Leser:innen den Zugang verbaut haben. Die ersten Kapitel werden aus der Ich-Perspektive von einem gewissen Mr. Lockwood erzählt, der auf der Suche nach Ruhe an einem abgelegenen Fleck Erde den Gutshof Thrushcross Grange mietet. Als er dem eigentlichen Besitzer, Heathcliff, einen Besuch abstattet, gerät er in einen Schneesturm, der ihn dazu veranlasst, eine gespenstische Nacht im Haus seines Vermieters zu verbringen. In Rückblenden erzählt ihm später die zweite Erzählerin des Romans, Nelly Dean, die in beiden Häusern als Kindermädchen und Haushälterin gearbeitet hat, die Geschichte der beiden Familien Earnshaw und Linton. In deren Mittelpunkt steht die leidenschaftliche, zerstörerische Liebesbeziehung von Cathy und Heathcliff, die das Leben zweier Familien und dreier Generationen beeinflusst. Da einige der Figuren aus unterschiedlichen Generationen dieselben Namen tragen, sind die deutschen wie auch die englischen Ausgaben fast immer mit einer genealogischen Tafel ausgestattet, damit man nicht gänzlich den Überblick verliert.
Die bildlichen Darstellungen von verbaler und physischer Gewalt, Alkoholsucht sowie Missbrauch bis hin zu Nekrophilie trugen dazu bei, dass die Rezeption zunächst verhalten ausfiel. Selbst im abgebrühten 21. Jahrhundert dürfte die skrupellose Rachsucht Heathcliffs und Cathys dominanter Egoismus kaum Sympathien hervorrufen. Aber gerade die thematische Vielfalt und das rigorose Vordringen in menschliche Abgründe sorgen für die lang anhaltende Faszination. Sturmhöhe lässt unzählige Lesarten zu – wurde Heathcliff in vielen frühen Interpretationen noch als verwaister Bengel, der zum Prototypen des Byron’schen Helden heranwächst, stilisiert, ist der Missbrauch sowie der offenkundige Rassismus, dem der Junge „[mit] seiner dunklen Haut“ ausgesetzt ist, inzwischen genug Erklärung für alles, was folgt.
Sturmhöhe (Wuthering Heights ist der Originaltitel) hat dementsprechend auch eine interessante Übersetzungsgeschichte vorzuweisen. Tatsächlich gehört der Roman neben Jane Eyre sowohl in Deutschland als auch weltweit zu den am meisten übersetzten englischsprachigen Klassikern. In über sechzig Sprachen ist der Roman inzwischen übersetzt worden. Seit der ersten Übertragung ins Deutsche im Jahr 1851 (wer übersetzt hat, ist nicht bekannt), sind mindestens zwölf weitere Übersetzungen auf dem deutschen Markt erschienen, die allesamt im 20. Jahrhundert veröffentlicht wurden. Die letzte Neuübersetzung stammt von Wolfgang Schlüter und erschien 2016 im Hanser Verlag. Die für diesen Artikel herangezogenen Übersetzungen wurden ausgewählt, weil sie entweder im Handel verfügbar oder online frei zugänglich waren. Andere Übersetzungen sind zwar antiquarisch erhältlich, werden aber in hier nicht berücksichtigt. An dieser Stelle folgt eine kurze Übersicht der hier besprochenen Übersetzungen:
Der Sturmheidhof/Sturmhöhe; übersetzt von Gisela Etzel (1908; Verlag: Hofenberg)
Die Sturmhöhe, übersetzt von Grete Rambach (1938; Verlag: Insel Taschenbuch/Suhrkamp)
Umwitterte Höhen, übersetzt von Alfred Wolfenstein (1941; Verlag: Büchner; verfügbar auch über Project Gutenberg)
Stürmische Hügel/Sturmhöhe, übersetzt von Gladys von Sondheimer (1947; Verlag: Diogenes)
Sturmhöhe, übersetzt von Siegfried Lang (1949; Verlag: Manesse, 2022 neu aufgelegt als Penguin Edition)
Sturmhöhe, übersetzt von Ingrid Rein (1986; Verlag: Reclam)
Sturmhöhe, übersetzt von Michaela Meßner (1997; Verlag: dtv)
Sturmhöhe/Wuthering Heights, übersetzt von Wolfgang Schlüter (2016; Verlag: Hanser)
Leider haben nicht alle Übersetzer:innen ein Nachwort zu ihrer Fassung hinterlassen und nicht alle, die eins schreiben durften, sind auch auf ihre Übersetzung eingegangen. Doch auch wenn sie nicht auf die Übersetzung eingehen, sind solche Nachwörter höchst aufschlussreich, weil sie Einblicke in die Interpretation des Übersetzers oder der Übersetzerin geben. Im Falle von Emily Brontë, deren Mythos das eigene Werk zuweilen überschattet, fühlen sich viele Kritiker wie auch Übersetzer (die männliche Form wurde hier bewusst gewählt) zu erstaunlichen Schlussfolgerungen und bisweilen fantastischen Auslegungen ihrer Person veranlasst.
Man kann hier fast von einer Art Tradition sprechen, die vermutlich mit dem folgenden oft zitierten Satz von Charlotte Brontë begann, der die Schwester vermutlich recht anschaulich charakterisieren sollte: „Stärker als ein Mann, einfacher als ein Kind, ein Wesen von ganz eigener Art“. Eine Fortsetzung dessen ist zum Beispiel W. Somerset Maughams Diagnose, dass Emily Brontë eine „hochmütige, eine anstrengende, unangenehme Person“ gewesen sei, obgleich er ihr Werk zu den zehn besten Romanen der Weltliteratur zähle. Weitergedacht wird dies beispielsweise von dem Übersetzer Siegfried Lang, der in seinem Nachwort behauptet, „sie war sensitiv“ und chauvinistisch urteilt: „[Die] Brontës, die nie geliebt hatten, nie geliebt wurden, aber die Liebe liebten, steigerten den Mann zu etwas Übermännlichem“. Noch unendlich interessanter ist Wolfgang Schlüters umfassendes Nachwort, in dem er Emily Brontës Vokabular als „Stichwortreservoir dieser angstbesetzten, nicht nur von Heathcliff repräsentierten Sphäre männlicher Penetration“ bezeichnet. Über die Psyche Emily Brontës lernen wir hier wenig, dafür aber umso mehr über die ihrer Übersetzer – und die ist für diesen Artikel besonders relevant.
Wir haben es also mit einem interpretatorisch überfrachteten Roman zu tun, wodurch einige Herausforderungen für die Übersetzenden entstehen. In einem solchen Fall gibt es oft nur zwei Wege: Entweder versuchen sich die Übersetzer:innen künstlich von allen äußeren Einflüssen zu befreien (ein Ansatz, der eigentlich zum Scheitern verurteilt ist) oder sie übersetzen ganz bewusst im Kontext der Übersetzungsgeschichte des Romans (was vor allem bei Wolfgang Schlüter der Fall ist). Eine weitere Herausforderung beim Übersetzen von Sturmhöhe ist die eigentümliche Sprache des Romans, die nicht nur ungewöhnlich ist, weil der Roman über 150 Jahre alt ist.
Emily Brontës Werk liest sich tatsächlich ganz anders als andere zeitgenössische, viktorianische Romane; es wird in längeren Dialogen, die zumeist mit einem Ausrufezeichen enden, leidenschaftlich beleidigt, geschrien oder geflucht. Sätze bleiben oft unvollendet und werden durch Gedankenstriche abgehackt. Einige Figuren sprechen in einem nordenglischen Dialekt. Die Wortwahl variiert von prätentiösen Formulierungen bis hin zu messerscharfen Beschimpfungen. An der Sprache scheiden sich die Geister: Die einen heben besonders die Mündlichkeit, die teilweise den Reiz dieses Romans ausmacht, hervor und argumentieren, es handle sich eigentlich um einen dramatischen Text. (Erstaunlicherweise wird Sturmhöhe trotz seiner narrativen Komplexität immer wieder auf deutschen bzw. britischen Bühnen aufgeführt – mit durchwachsenem Erfolg.) Andere verweisen auf die Naturbeschreibungen und erkennen darin das Dichterische einer Autorin, von der ansonsten nur noch Gedichte überliefert sind. Wir stellen fest, dass sich Sturmhöhe auch in formaler und sprachlicher Hinsicht kaum kategorisieren lässt, und halten nach all diesen Elementen beim Sichten der Übersetzungen Ausschau.
Eine erste Hürde stellt die Übersetzung des Romantitels „Wuthering Heights“ dar, der gleichzeitig sowohl der Name des zentralen Schauplatzes in der fiktiven Welt ist als auch die Atmosphäre der Yorkshire-Landschaft einfängt. In den letzten Jahrzehnten hat sich „Sturmhöhe“ als deutsche Übersetzung etabliert, sodass ältere Übersetzungen, die eigentlich unter anderen Titeln wie „Sturmheidhof“ oder „Stürmische Hügel“ erschienen sind, inzwischen als „Sturmhöhe“ verlegt werden – wenn es um die Titel von Übersetzungen geht, haben Verlage in den meisten Fällen das letzte Wort (so erschien beispielsweise auch die Hanser-Ausgabe nicht unter dem Originaltitel, für den Wolfgang Schlüter plädiert hatte). In vielen Übersetzungen erfolgt allerdings im Roman ein Wechsel zurück zum ursprünglichen Namen „Wuthering Heights“, dessen Bedeutung direkt zu Beginn des Romans erklärt wird:
Diese kurze Textstelle befindet sich am Anfang des ersten Kapitels. Es handelt sich hierbei weniger um einen Kommentar des Erzählers (was weiß der neu zugezogene Lockwood schon über den Namen des Anwesens?), sondern der Autorin, die anscheinend sicher gehen wollte, dass auch englischsprachige Leser:innen „Wuthering Heights“ einordnen können. Gisela Etzel ist die einzige Übersetzerin, die „Wuthering Heights“ nicht verwendet und durchgängig die von ihr gewählte deutsche Übersetzung „Sturmheidhof“ nutzt. Als Einzige hat sie auch den Namen des zweiten Schauplatzes, „Thrushcross Grange“, ins Deutsche übertragen: „Drosselkreuz“ heißt der Ort in ihrer Übersetzung. Damit – und diesen Eindruck bestätigt auch die restliche Übersetzung – deutscht Gisela Etzel insgesamt mehr ein als andere Übersetzer:innen, denn diese kehren im Gegensatz dazu im Text zu den Originalnamen zurück.
Ältere Übersetzungen fügen an der zitierten Stelle zumindest noch eine deutsche Erklärung ein, während Siegfried Lang, Michaela Meßner und Wolfgang Schlüter auch darauf gänzlich verzichten, was gemessen an dem Bekanntheitsgrad von Wuthering Heights nicht unbedingt verwerflich ist. Zudem hat sich in den letzten Jahrzehnten abgezeichnet, dass die Eindeutschung von Namen aus der Mode kommt bzw. so viele Probleme mit sich bringt, dass viele Übersetzer:innen davon absehen. Würde man bei einem Roman wie Wuthering Heights mit der Eindeutschung von Ortsnamen beginnen, könnte man auch alle sprechenden Figurennamen, zum Beispiel Heathcliff oder Hareton, ins Deutsche bringen, was sicherlich aus guten Gründen bislang noch niemand getan hat.
Beim Lesen mögen solche schwer auszusprechenden Namen nur bedingt irritieren, aber wir können davon ausgehen, dass über Bücher auch gesprochen wird – in Buchhandlungen, in Leserunden, im Privaten. Selbst für englische Muttersprachler:innen gibt es im Internet dutzende Artikel, die erklären, wie man das Wort „Wuthering“ auszusprechen hat. Im Spectator schreibt ein Kolumnist: „Mir fällt kein Wort ein, der öfter falsch ausgesprochen wird als Wuthering Heights“. Aus diesem Grund ist eine deutsche Übersetzung des Titels wünschenswert, auch wenn man sich entscheidet im Text von „Wuthering Heights“ (dabei geht es vor allem um den Gutsnamen) zu sprechen.
Mit Blick auf die anderen Übersetzungsversuche von „Wuthering Heights“ kristallisiert sich allerdings „Sturmhöhe“ als die beste Variante heraus – und das nicht nur, weil der Roman inzwischen unter dem Titel bekannt ist. „Stürmische Hügel“ klingt weder beeindruckend noch besonders furchteinflößend, „Umwitterte Höhen“ oder „Sturmumwitterte Höhen“ hingegen sind umständliche Formulierungen. Eine Übersetzung wie „Sturmheidhof“ reduziert den Titel zudem um mindestens eine Bedeutungsebene, weil eine klare Objektivierung erfolgt. Das Kompositum „Sturmhöhe“ ist im Vergleich dazu wesentlich eingängiger und vage genug, um unserer Fantasie freien Lauf zu lassen.
Der kurze Auszug gibt jedoch auch einen Einblick in andere Unterschiede zwischen den einzelnen Übersetzungen und den einzelnen übersetzerischen Entscheidungen. Diese beginnen beim Satzbau, der im gesamten Roman so einige Tücken aufweist. Die meisten Übersetzer:innen versuchen bei der Übertragung des Satzes „One may guess the power of the northwind …“ der Länge des Originals zu folgen, lediglich Wolfenstein nimmt hier eine Teilung in zwei Sätze vor. Sowohl Meßner als auch Schlüter schaffen hier mit einem Gedankenstrich die Überleitung zum vorherigen Satz nachzuahmen, die alle Anderen mehr oder weniger ignorieren.
Interessant, wenn auch nur bedingt elegant, ist Ingrid Reins Entscheidung den Nebensatz „dem der Ort bei stürmischem Wetter ausgesetzt ist“ nicht ans Ende des einleitenden Satzes zu setzen, sondern ihn dazwischen zu schieben. Ähnlich spannend wird es auch bei der Wortwahl. Während beispielsweise Rein „extrem“ für noch mal mehr Emphase vor zwei ohnehin schon aussagekräftige Adjektive setzt, ist das Wetter auf Wuthering Heights bei Wolfenstein lediglich ein bisschen „unruhig“ statt stürmisch. Des Weiteren übersetzen Meßner und Schlüter „the power of the north wind“ anders als ihre Vorgänger:innen mit „Kraft“ und „Wucht“ zwar näher am Original, aber es dimmt die raue Atmosphäre.
Der Auszug aus Schlüters Übersetzung ist an dieser Stelle besonders interessant, weil seiner Fassung von 2016 ein gewisser Ruf vorauseilt, der mutmaßlich das Resultat einer Marketingstrategie ist: Anders als seine Vorgänger:innen habe er an vielen Stellen Wörter aus der Umgangssprache gewählt und lasse die Romanfiguren wie „Aggro-Rapper aus Neukölln“ fluchen. An dieser Stelle ist davon nicht mal ansatzweise etwas zu spüren. Schlüters Übersetzung ist hier genauso weit vom 21. Jahrhunderts entfernt wie andere Übersetzungen: „[Ein] charakteristisches Eigenschaftswort“ ist die denkbar ungelenkste Übertragung von „a provincial adjective“ und Einfügungen wie „wohl wahr“ und „wohlweislich“ helfen kaum dabei, die Geschichte oder deren Sprache gegenwärtiger wirken zu lassen.
Kommen wir zu einem weiteren Textbeispiel. Der folgende Dialog ereignet sich nach einem Streit zwischen Heathcliff und Cathy, die regelmäßig von ihrem zukünftigen Ehemann Edgar Linton besucht wird. Ihr älterer Bruder und Hausherr Hindley, ein unberechenbarer Alkoholiker, unterhält sich mit Joseph, einem alten Bediensteten, der in einem nordenglischen Dialekt spricht. Anwesend sind auch Cathy und das Dienstmädchen Nelly Dean, die Erzählerin der Geschichte:
In dem gesamten Roman ist Josephs alter Yorkshire-Dialekt am ausgeprägtesten und dient sowohl der Figurenzeichnung als auch der Lokalisierung. Joseph ist eine seltsame Figur, er ist ein selbstgerechter Moralapostel, der seit Jahren der Familie dient und seine Meinung jederzeit bereitwillig und ungefragt verkündet. Der Dialekt markiert nicht nur den Standesunterschied, sondern signalisiert zugleich seinen Mangel an Bildung. Zugleich verleiht der Dialekt seinen Reden eine komische Note, sodass die überzeichnete Figur oftmals als Karikatur gelesen wird. Richtig ernst nimmt ihn auf Wuthering Heights niemand – und das sollen auch die Leser:innen nicht.
Auch englische Muttersprachler:innen empfinden den Yorkshire-Dialekt teilweise als schwer verständlich und unlesbar, zumal der Dialekt seit dem 19. Jahrhundert auch zunehmend weniger gesprochen und nur bedingt positiv wahrgenommen wird, da gerade in Großbritannien Dialekte noch heutzutage als Zeichen des gesellschaftlichen Standes aufgefasst werden. Tatsächlich hatte schon Charlotte Brontë Sorge, dass die Leser:innen in anderen Gegenden Großbritanniens nicht in der Lage sein würden, den von Emily sehr treffend übertragenen Dialekt zu verstehen und nahm in der zweiten Ausgabe von Wuthering Heights, für die sie das Vorwort schrieb, einige Anpassungen vor.
Die Übertragung des Dialekts fällt sehr unterschiedlich aus. Manche Übersetzer:innen lassen ihrer Kreativität freien Lauf (Etzel, Schlüter), andere deuten ihn durch recht zaghafte Wortverkürzungen zumindest an (Meßner, Rein, Rambach) und einige lassen ihn gänzlich weg (Lang, Wolfenstein, Sondheimer). Letzteres ist die bequemste, aber auch fadste Lösung. Sturmhöhe thematisiert die Unterschiede zwischen den Klassen und Heathcliffs Streben nach sozialem Aufstieg. Dass solche Unterschiede auch über die Sprache verhandelt werden, sollte in der Übersetzung zumindest angedeutet werden, vor allem dann, wenn sich Josephs Figurenrede so klar von anderen Figuren abhebt.
Eine Dialektübertragung ist mit einigen Problemen behaftet, denn welcher deutschsprachige Dialekt würde an einer solchen Stelle passen? Und werden damit die Leser:innen nicht völlig aus dem Yorkshire-Dorf gerissen? Zudem ziehen klar zuordenbare, deutschsprachige Dialekte ihre ganz eigene, oft hochkomplexe Historie mit sich. In Etzels Übersetzung sticht der Dialekt in dieser Hinsicht nicht allzu negativ hervor, da sie sich insgesamt um eine stärkere Eindeutschung bemüht hat als ihre Nachfolger:innen und der Text somit weniger stark in Nordengland verankert ist. Der Vergleich der Übersetzungen zeichnet nach, wie die Dialektübersetzung in den letzten Jahrzehnten langsam wieder hervortritt, nachdem fast alle Übersetzer:innen Mitte des 19. Jahrhunderts den Dialekt des Originals völlig ignoriert haben.
Ob diese Tendenz andeutet, dass Übersetzer:innen inzwischen mehr wagen oder womöglich auch die Toleranz der Leser:innen für solch sprachliche Akrobatik gestiegen ist, sei jedem selbst überlassen. Unter Umständen ist an solchen Stellen tatsächlich die Verwendung eines Kunstdialekts, der deutlich als Dialekt identifizierbar ist, aber nicht klar verortbar ist, die eleganteste Lösung. Schlüter hat sich für einen nicht immer konsequenten Dialektmix aus „Krems, Ottakring und Wiener Neustadt“ entschieden. Dieser funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Auf jeden Fall wirkt der Dialekt, wenn man die Wiener Mundart nicht kennt, durchaus befremdlich. In anderen Ohren, denen ein solcher Dialekt vertrauter sein mag, klingt die Mundart unter Umständen aufgesetzt – beides entspricht der Wirkung, die Josephs Rede an solchen Stellen im Original entfaltet.
Anerkennend hervorzuheben ist, dass einige Übersetzer:innen hier zwar nicht mit einem ausgeprägten Dialekt arbeiten, aber dennoch sprachlich klangvoll arbeiten. Michaela Meßner beispielsweise schafft es durch Wiederholung von „fein“ und die Doppelungen von „du“ und „dich“ („du miese Schlampe, du Hexe du, dich hab“) Josephs ohnehin anklagendem Tonfall eine theatralische Note zu verleihen. Seine verzweifelten Ausrufe („Bin ich aber nich, von wegen!“) lassen ihn wie ein trotziges Kind wirken.
Glättungen in den Übersetzungen betreffen aber oftmals nicht nur die dialektalen Passagen, sondern auch die Flüche und verbalen Beleidigungen, die in dieser Textstelle mannigfach zu finden sind. In dieser Hinsicht stechen die konservativen Übersetzungen von Wolfenstein und Lang aus den 1940er Jahren besonders hervor. Während in Rambachs Fassung von 1938 das Dienstmädchen Nelly als „nixnutzige, schlampige Hex“ bezeichnet wird, beschimpft man sie bei Wolfenstein komischerweise als „loddriges Frauenzimmer“. Vielleicht handelt es sich dabei um einen der schlimmsten Vorwürfe, den man Frauen im Jahr 1941 machen konnte – oder Wolfenstein hat sich so den Straßensprech des 19. Jahrhundert vorgestellt. Ähnlich brav geht es in der Lang’schen Übersetzung von 1949 zu. „[Shoo’s] a fine lass“ wird hier von Lang als „[sie ist] ein musterhaftes Mädchen“ übertragen; im Vergleich dazu ist bei Rein von einem „hinterfotzig[em] Weibsstück“ die Rede.
Solche kurzen Auszügen zeigen ganz unterschiedliche interpretatorische Ansätze. Rein liest Joseph als anstrengenden, misogynen Besserwisser, daher ist ihre recht freie Übersetzung im Kontext des Romans durchaus passend. Lang jedoch ging offenbar davon aus, dass der Satz auch im Deutschen ohne mehr Nachdruck seine Ironie entfalten kann, was auch der Fall ist. Wie zuvor bereits erwähnt, schreibt er der Autorin durchaus wohlwollend im Nachwort eine Sensitivität zu, als hätte er sie persönlich gekannt: „Kontemplation waren ihr tiefstes Bedürfnis. Fühlen, Denken, Phantasie lebten voll erst in ihrer Dichtung auf“, heißt es dort.
Ein weiteres Beispiel für die angestrebte Förmlichkeit ist die Verwendung von „Sie“ und „du“ in Langs Übersetzung. In seiner Übertragung redet Joseph das Dienstmädchen Nelly mit „Sie“ an, während alle anderen Übersetzer:innen an dieser Stelle das „du“ gewählt haben. Das ständige Siezen bei Lang ergibt tatsächlich wenig Sinn, da Joseph Nelly zusammen mit Heathcliff und Cathy (alle sind ungefähr ähnlichen Alters) hat aufwachsen sehen. Auch Heathcliff und Cathy siezen in seiner Version Nelly, obgleich sehr deutlich ist, dass sie einen Status innehat, der über den eines durchschnittlichen Dienstmädchens hinausgeht. Sie ist ein weiteres Familienmitglied, eine enge Vertraute in einer Welt, in der sich alle pausenlos Beleidigungen an den Kopf knallen. Ein „Sie“ lässt solche Schimpfereien sehr steif wirken. Dementsprechend fällt auch seine Übersetzung zurückhaltender, gefasster und vergleichsweise deutlich gediegener aus. Zuweilen wirkt es so, als hätte Lang lieber einen Austen-Roman übersetzt.
Als Letztes soll an dieser Stelle noch eine interpretatorische Abweichung Schlüters hervorgehoben werden, denn eine neue Herangehensweise an den Text kann auch ihre Tücken haben, vor allem wenn man augenscheinlich alles in einem gänzlich neuen Licht lesen will. In seiner Fassung (und auch in der gekürzten Übersetzung von Sondheimer), fühlt Hindley der kranken Cathy den Puls. Natürlich könnte mit „taking her wrist“ eine solche Handlung gemeint sein, aber warum sollte ausgerechnet Hindley, ein gewalttätiger Grobian, so etwas tun? Zumal er ein paar Absätze später „einen Sturzbach höhnischer Schmähungen auf sie nieder[lässt]“. Diese wohlwollende Darstellung Hindleys wird sich in einem später folgenden Zitat bestätigen.
Kommen wir zur nächsten Textstelle. Besonders interessant sind in diesem Roman die Geschichte Heathcliffs. Cathys und Hindleys Vater unternimmt eine Geschäftsreise nach Liverpool, von der er mit einem Waisenkind im Schlepptau zurückkehrt. Dieses Waisenkind wird Heathcliff getauft. Woher er stammt und wer seine Eltern sind, ist nicht bekannt, bietet aber Stoff für alle möglichen Spekulationen. Es findet dabei eine deutliche Exotisierung statt. „Er ist ein dunkelhäutiger Zigeuner“ (Ü Rambach; „He is a dark-skinned gipsy“) heißt es im Roman. Seine dunklere Hautfarbe sowie sein wenig durchschaubares Auftreten sind oft Gegenstand rassistischer Beleidigungen. Als Cathy ein Interesse an Edgar Linton entwickelt, wird Heathcliff eifersüchtig. Hier spricht er mit Nelly Dean:
Heathcliff ist nicht nur ein Außenseiter, weil er als Waise in die Familie kommt, sondern auch weil er „anders“ aussieht. Liverpool, die Stadt, in der er aufgelesen wird, war im 19. Jahrhundert ein Zentrum des Sklavenhandels. Daher ist es durchaus plausibel – und zahlreiche Anspielungen deuten darauf hin – ihn als Kind versklavter Menschen und als Person of Colour zu lesen, was Andrea Arnold in ihrer Verfilmung von 2011 gemacht hat. (Bis dato wurde Heathcliff eher von weißen, mittelalten Männern mit langen Haaren gespielt.) Das bedeutet nicht, dass man den Roman oder die Figur Heathcliff zwangsläufig so lesen muss – es ist lediglich eine von vielen Lesarten, die beide ihre Daseinsberechtigung haben.
Sturmhöhe ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass auch englischsprachige Texte, die sich nicht primär mit dem britischen Imperialismus auseinandersetzen (die Moore Yorkshires könnten von den englischen Kolonien nicht weiter entfernt sein), diesen oftmals als Plot Device verwenden und unterschwellig verarbeiten. In Jane Eyre bringt Rochester seine erste Ehefrau aus einer Kolonie mit nach England, in Jane Austens Mansfield Park bezieht das Familienoberhaupt sein Vermögen aus einer Plantage in Antigua und selbst in Elizabeth Gaskells Sittenroman Cranford gibt es zahlreiche Anspielungen auf den globalen Handel und die zahlreichen Expansionsversuche des britischen Königreichs.
Dies zeigt vor allem, dass der Umgang mit der Kolonialgeschichte und inzwischen politisch sensiblen Begriffen nicht nur dann ein Problem ist, wenn der Roman beispielsweise den Status als postkoloniales Werk innehat oder von einer Person of Colour verfasst wurde. Das Übersetzen von Klassikern weist in dieser Hinsicht reihenweise Tücken auf, da sich mit der Zeit auch die übersetzerischen Konventionen wandeln. In der Übersetzungsgeschichte von Sturmhöhe lässt sich der sich stetig wandelnde Umgang mit bestimmten Begriffen nachvollziehen. Während die älteren Übersetzungen das damals übliche N‑Wort benutzen, dem Etzel mit dem Zusatz „schwarz wie“ sogar noch Emphase verleiht, wird gegen Ende des 20. Jahrhunderts die Bezeichnung „Schwarzer“ bevorzugt. In Langs Übersetzung, die im April 2022 als deutsche Penguin Edition erscheint, wurde das N‑Wort gestrichen und ebenfalls durch „Schwarzer“ ersetzt.
Schlüters Übersetzung mit „rabenschwarzer Mohr“ ist in vielerlei Hinsicht sowohl rückschrittlich als auch schlicht inkonsequent. In seinem Nachwort verkündet er: „[Wo] einst dem viktorianischen Leser indigniert oder schockiert der Atem stocken mochte, da zuckt ein anno 2015 verrohter Leser nur mit den Achseln, wenn Übersetzung hier keine wirkungsadäquate Wiedergabe wagt“. In dieser Passage, wie auch in allen anderen bereits aus der Übersetzung zitierten, handelt es sich bei einer Übersetzung wie „rabenschwarzer Mohr“ jedoch eher um eine künstliche Historisierung, die wenig mit dem Original zu tun und auch als Beschimpfung nicht besonders überzeugend ist. Schlüter legitimiert mit dem Zitat die Verwendung von umgangssprachlichen Begriffen wie „Vollkoffer“ und „scheiße“ – die eigentlich nur sporadisch stattfindet –, die unnötig enge Übertragung der Interpunktionen und Absatzstruktur des Originals (man darf sich ruhig fragen, was dieses Vorgehen mit Wirkungsäquivalenz zu tun hat) sowie die Dialektisierung von Figurensprech, der im Original keinen Dialekt enthält. In seiner Version sagt Heathcliff Sätze wie „Wo isse denn, meine liebwerte Gattin?“ oder „Ach! Meine Herztrauteste!“, die seine Leidenschaft ins Lächerliche ziehen.
Heutzutage ebenfalls problematisch ist die Bezeichnung „Zigeuner“, die sich hier als Übersetzung für „Gipsy“, das im englischen Sprachraum inzwischen auch als rassistisch eingestuft wird, mehrfach finden lässt. Der Roman reproduziert nicht nur gängige Rassismen seiner Zeit, sondern seine Charaktere verwenden solche Begriffe Heathcliff gegenüber, um diesen bewusst zu beleidigen – es findet über die Sprache ein klares „Othering“ seiner Figur statt. Solche Rassismen tatsächlich gar nicht zu übersetzen, hätte gravierende Auswirkungen auf die Figurenzeichnung und würde somit die Wirkung des Romans signifikant beeinträchtigen. Daher wäre die wohl angemessenste Lösung, solche Stellen nicht unkommentiert zu lassen, sondern Übersetzer:innen in Klassikerausgaben – die heutzutage ohnehin meist mit Nachwörtern, Essays und editorischen Notizen versehen sind – die Möglichkeit zu geben, die Übersetzung einzelner Wörter zu kommentieren (Schlüter erhielt die Gelegenheit und lässt „Mohr“ aber unkommentiert stehen).
Zuletzt soll hier noch darauf hingewiesen werden, dass die Übersetzung von Gladys van Sondheimer Streichungen und Kürzungen enthält. Aufmerksamen Leser:innen sind diese eventuell schon in dem vorherigen Zitat aufgefallen. In dieser zitierten Passage sind die Eingriffe jedoch noch auffälliger. Das gesamte Gespräch zwischen Nelly und Heathcliff wurde hier zu einem einzigen Teilsatz zusammen gekürzt. Aus welchen Gründen die Straffungen vorgenommen wurden, kann nur gemutmaßt werden. Die zitierte Passage stammt aus der Diogenes-Ausgabe von 1999, die weder ein Vorwort noch ein Nachwort enthält, und wird aufgrund der Auslassungen in diesem Artikel nicht empfohlen wird.
Kommen wir zu einem letzten Beispiel. In dieser Szene tyrannisiert Hindley, der sich im Laufe des Romans immer mehr seiner Alkoholsucht hingibt, Nelly Dean und seinen Sohn Hareton, den er seit dem Tod seiner Frau grob vernachlässigt hat:
Eine der effektivsten Übersetzungen dieser Stelle stammt von Meßner, die hier wieder ein Beispiel für eine gelungene Wortwiederholung (siehe „besser“) liefert. Die Ausrufezeichen gepaart mit dem vergleichsweise harten „Mach den Mund auf“ unterstreichen Hindley unberechenbaren Charakter, der vor Drohungen jeglicher Art nicht zurückschreckt. Ebenfalls treffend ist die Übersetzung „dieser widerwärtige kleine Bengel“. Das Kleinkind ganz als „Schurke“ zu bezeichnen, schießt etwas über das Ziel hinaus, auch wenn Hindley alles zuzutrauen ist. Bengel ist zwar umgangssprachlich, aber auch altmodisch genug, um in ein ländliches Setting zu passen.
Gisela Etzel hat für ihre Fassung ein Vorwort geschrieben, in dem sie aus einer früheren Übersetzung zitiert und erstaunt kommentiert: „So schrieb man noch in den siebziger Jahren. Doch welch eine Wandlung im Geiste von damals zu heute!“ Ähnliches lässt sich nun – über hundert Jahre später – auch über ihre Übersetzung schreiben. Etzels Übersetzung ist keineswegs schlecht, aber sie ist gealtert, vor allem mit Blick auf die Wortwahl: „Entartetes Fund“ und „ich liebe etwas Rassiges“ sind rechte freie Übersetzungen der Originalpassagen, die heutzutage die meisten Leser:innen stutzig machen sollten.
Auch der Übersetzung von Siegfried Lang merkt man ihr Alter an und die angestrengte Zähmung des Ausgangstextes sorgt dafür, dass sich gestelzte Beleidigungen wie „du unnatürliches kleines Tier“ der Übersetzung eine unfreiwillige Komik verleihen, die im Original nicht zu finden ist. Ähnlich gedämpft klingt auch Alfred Wolfensteins Übersetzung, in die es kaum ein Ausrufezeichen aus dem Original geschafft hat – selbst als Lockwood von den Geisterhänden Cathys umfasst wird, endet der Satz in einem Punkt. Dem Pathos des Originals wird er damit wenig gerecht. Am besten schneidet unter den älteren Übersetzungen daher die Fassung von Grete Rambach ab, die sicherlich auch an manchen Stellen Alterungsspuren aufweist, aber flüssig, an einigen Stellen wagemutig und insgesamt gut lesbar ist.
Ähnlich zurückhaltend wie einige Vorgänger übersetzt auch Rein, bei der „vagaries“ hier zu „wunderlichen Einfällen“ werden – eine sehr beschönigend Formulierung dafür, dass Hindley Nelly ein Messer in den Mund schiebt – und aus „goblins“ „Gespenster“, vielleicht als Verweis auf Catherines Gespenst, das später die Anwohner von Wuthering Heights heimsuchen wird. Zwar tauchte bei ihr auch das „hinterfotzig[em] Weibsstück“ auf, aber bei einer solch beschwingteren Übersetzung (die oft an eigentlich unpassenden Stellen auftreten) handelt es sich eher um eine Ausnahme als die Regel. Das Ordentliche kommt in ihrer Übersetzung oft stärker zum Ausdruck als das Wilde.
Zudem setzt sich bei ihr zuvor bereits angedeutete Tendenz, Sätze umständlich einzuschieben, in der gesamten Übersetzung fort. Beispielsweise wird bei ihr aus „Mr. Heathcliff and I are such a suitable pair to […]“ zu „Mr. Heathcliff und ich, wir sind genau die Richtigen, um […]“. An manchen Stellen kann so etwas durchaus funktionieren, aber in ohnehin langen Sätzen strengen solche Konstruktionen an, auch weil Rein zusätzlich noch dazu tendiert Passivkonstruktionen einzubauen, wo die Konkurrenz tendenziell aktivisch übersetzt: „Er ahnte ja nicht, wie sympathisch er mir wurde“ („He little imagined how my heart warmed towards him)“.
Vergleichsweise gut gelingt es auch Schlüter an der oben zitierten Stelle, das Stakkatohafte des Originals zu imitieren, indem er einige Sätze kürzer macht, als sie es im Original ohnehin schon sind. Aus „open your mouth“ wird bei ihm zum Beispiel „Mund auf“. Im Vergleich dazu arbeiten Rein oder Wolfenstein mit deutlich längeren Sätzen. Aus „something fierce and trim“ wird bei Wolfenstein beispielsweise „Wild und glatt muß man aussehen“, was den Text deutlich entschleunigt, während Schlüter die Beifügung auf „wild & schmuck“ reduziert.
Schlüter arbeitet jedoch keineswegs als Einziger mit Gedankenstrichen und Verkürzungen; auch andere Übersetzer:innen (Meßner oder Lang, obgleich seine Übersetzung durch Verwendung von „Sie“ ausgebremst wird) versuchen hier den Rhythmus des Originals nachzuahmen. Es handelt sich also nicht um ein Alleinstellungsmerkmal seiner Übersetzung, auch wenn man ihr in dieser Hinsicht vielleicht die größte Effektivität zusprechen mag. Trotzdem soll hier noch einmal darauf verwiesen werden, dass Schlüters Übersetzung es auch an dieser Stelle nicht vermag, zu überzeugen. Aussetzer in der Wortwahl wie „unnatürlicher Fratz“ oder das seltsame stockende „unter keinen Umständen würde ich es zu mir nehmen“ (es geht hier um ein Messer) lassen die Übersetzung erneuert erstaunlich altbacken wirken.
Wer sich also zum allerersten Mal der Lektüre eines der aufregendsten und komplexesten Bücher des 19. Jahrhunderts widmen will, sei vor Schlüters Übersetzung gewarnt. Kenner:innen anderer Übersetzungen mögen darin zumindest den Versuch einer originellen Herangehensweise an das Original erkennen. Für Neueinsteiger:innen jedoch kann die Lektüre eigentlich nur eine Qual bedeuten. Ebenfalls wenig empfehlenswert sind die meisten Übersetzungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Etzel, Wolfenstein und Lang), die entweder Alterungsspuren aufweisen, die die Rezeption des Textes unter Umständen negativ beeinflussen, oder durch ihre künstliche Förmlichkeit nicht dieselbe Intensität wie das Original erreichen. Ingrids Reins solide Übersetzung aus den 80er-Jahren gerät an einigen Stellen ebenfalls zu brav. Wir bleiben demnach bei Michaela Meßners Übersetzung von 1997 hängen, die den bislang besten und schlüssigsten Versuch darstellt, Emily Brontës Sturmhöhe mit all seinen Eigenheiten ins Deutsche zu bringen. Gemessen an der andauernden Erfolgsgeschichte des Romans ist es nicht unwahrscheinlich, dass in den kommenden Jahren eine weitere Neuübersetzung erscheint. Es bleibt also spannend.