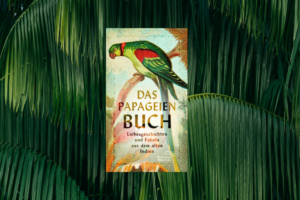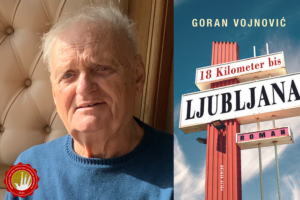Es gibt etwa 7000 Sprachen auf der Welt, doch nur ein winziger Bruchteil davon wird ins Deutsche übersetzt. Wir interviewen Menschen, die Meisterwerke aus unterrepräsentierten und ungewöhnlichen Sprachen übersetzen und uns so Zugang zu wenig erkundeten Welten verschaffen. Alle Beiträge der Rubrik findet ihr hier.
Wie hast du Estnisch gelernt?
Ich war als Elfjähriger mit meinen Eltern zum Sommerurlaub in Finnland und habe mich prompt unsterblich in das Land und seine für mich damals exotische Sprache verliebt. Noch als Schüler belegte ich Volkshochschulkurse in Finnisch, und nach dem Abitur war völlig klar, dass ich genau das studieren musste, denn nach einigen weiteren Finnlandurlauben war die Liebe keineswegs erkaltet. Ich merkte schnell, dass es das Fach Finnisch an deutschen Universitäten gar nicht gab, sondern nur „Finnougristik“. Estnisch ist mit ca. einer Million SprecherInnen die drittgrößte finno-ugrische Sprache und mit dem Finnischen etwa so nah verwandt wie das Deutsche mit dem Niederländischen. Aber das konnte man damals, Anfang der 1980er Jahre, nicht als Schwerpunkt wählen, ganz abgesehen davon, dass ich mich wirklich vorwiegend für das Finnische interessierte.
1982 war ich nach Abschluss des vierten Semesters und vor dem Umzug nach Helsinki, wo ich ein Jahr studieren würde, im Sommer in Tallinn, was damals als Hauptstadt der Estnischen Sozialistischen Sowjetrepublik noch hinter dem Eisernen Vorhang lag. Die mittelalterliche Altstadt hat mich ausgesprochen fasziniert, und noch interessanter war, dass ich mich mit meinen mäßigen Finnischkenntnissen durchaus verständigen konnte. Denn viele Esten konnten Finnisch, weil sie ständig das finnische (West-)Fernsehen sahen. Als ich dann in Helsinki studierte, wurde mein Interesse am Estnischen noch mehr geweckt, weil man die Sprache und ihre Literatur dort studieren konnte. Und ein Wochenendtrip nach Tallinn war die normalste Sache der Welt, die Schiffspassage dauerte nur vier Stunden. Ich unternahm auch einige solche Reisen und belegte im Sommer 1983 einen dreiwöchigen Sprachkurs in Estland, was damals etwas ganz Besonderes war. Das war eine Art Sprachbad, an dessen Ende ich Estnisch sprach. Mit soliden Finnischkenntnissen und Deutsch als Muttersprache ist Estnisch tatsächlich in so kurzer Zeit zu erlernen, da die Sprache siebenhundert Jahre vom Deutschen beeinflusst und die ganze Syntax vergleichsweise „unfinno-ugrisch“ ist. Außerdem bestehen über 20 Prozent des Wortschatzes aus niederdeutschen und deutschen Lehnwörtern. Das kommt alles durch die Eroberung und Christianisierung durch deutsche Kreuzritter im 13. Jahrhundert, was zu einer deutschsprachigen herrschenden Oberschicht führte, die bis zur staatlichen Unabhängigkeit 1918 das Sagen im Land hatte.
Wie sieht die estnische Literaturszene aus?

Bunt, vielseitig, reich. Je kleiner die Sprecherzahl, desto höher die pro-Kopf-Buchproduktion, das ist ein bekanntes Phänomen. Manchmal denke ich, dass eigentlich jeder Este und jede Estin einen Gedichtband zu Buche stehen hat. Durch ein gutes staatliches Fördersystem kann man auch leicht an Druckkostenzuschüsse kommen, viele verlegen ihre Bücher daher selbst und verteilen sie an ein Dutzend maßgebliche Buchhandlungen. Verlage spielen dadurch eine weniger prominente Rolle auf dem literarischen Feld, das ansonsten natürlich wie anderswo auch funktioniert: Man muss schon Rezensionen in den maßgeblichen Medien und von maßgeblichen AutorInnen bekommen, ganz klar.
Durch die hauptsächliche Konzentrierung auf zwei Städte – neben der Hauptstadt Tallinn die Universitätsstadt Tartu im Südosten – ist die Szene einigermaßen überschaubar, sodass es nicht schwierig ist, direkte Kontakte zu knüpfen, wenn man dort ist. Es gibt unheimlich viele Veranstaltungen, auf denen man Autorinnen und Autoren treffen kann, und meine Erfahrung ist, dass alle immer offen und zugänglich sind, es gibt Ausländern gegenüber wenig Dünkel. Esten sind froh und dankbar, wenn jemand ihre Sprache spricht und sie nicht mit den Letten und Litauern verwechselt oder auch nur in einen Topf wirft, wie es immer wieder geschieht.
Was sollte man unbedingt gelesen haben?
In erster Linie Jaan Kross (1920–2007), die langjährige Nobelpreishoffnung der Esten. Gerade erschienen ist Gegenwindschiff, das ich gemeinsam mit einem Kollegen übersetzt habe. Aber vor allem seine früheren (von Helga Viira übersetzten) historischen Romane wie Der Verrückte des Zaren, Das Leben des Balthasar Rüssow, Professor Martens‘ Abreise und Die Frauen von Wesenberg oder Der Aufstand der Bürger, die alle zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert spielen und einen faszinierenden Einblick in die wechselvolle Geschichte Estlands geben, sind echte Klassiker. Denn es sind nicht nur historische Romane, sondern eben auch zutiefst philosophische und, wenn man will, politische Werke. Dann natürlich Andrus Kivirähks Der Mann, der mit Schlangen sprach, ein ebenso melancholischer wie humorvoller Roman über den Verlust unserer Bindung mit der Natur.
Viivi Luiks großartiger essayistischer Wurf über die kulturelle Begegnung zwischen Nord und Süd, die den Ost-West-Gegensatz in den Schatten stellt (Schattenspiel), aber natürlich auch ihre früheren Romane Der siebte Friedensfrühling und Die Schönheit der Geschichte. Tja, und dann den Klassiker aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Anton Hansen Tammsaare, oder eben das Nationalepos von Friedrich Reinhold Kreutzwald, Kalevipoeg, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da fängt die estnische Literatur an. Alles frühere war epigonal, übersetzt oder sporadisch, wenngleich die mündlich tradierte Folklore sehr, sehr alt ist. Aber sie wurde erst im 19. Jahrhundert aufgezeichnet.
Was ist noch nicht übersetzt?
Sehr viel, ich kann Dutzende von Autoren nennen, mit denen ich in der deutschen Verlagslandschaft hausieren gehe, Klassiker wie zeitgenössische. Rein Raud ist zum Beispiel ein Autor, der in über ein halbes Dutzend Sprachen übersetzt ist, aber noch nicht auf Deutsch vorliegt. Seine Romane behandeln die jüngste estnische Geschichte (Täiusliku lause surm), die zeitgenössische Gesellschaft und manche spielen auch in der Zukunft (Viimane kustutab tule). Die Autorin Kai Aareleid hat einen ergreifenden Roman über die Nachkriegszeit geschrieben (Linnade põletamine), der erwähnte Andrus Kivirähk hat eine Reihe von fantastischen Kinderbüchern geschrieben (Oskar ja asjad, Tilda ja tolmuingel), Ene Mihkelson hat beeindruckende Romane zur sowjetischen Vergangenheitsbewältigung vorgelegt (Ahasveeruse uni, Katkuhaud), Mehis Heinsaar herrlich psychodelisch-kafkaeske Kurzgeschichten und und und – es gibt eigentlich für jeden Geschmack etwas. Ganz zu schweigen von der Lyrik, wo es noch viel zu entdecken gibt. Aber die irgendwo unterzubringen ist doppelt schwer.
Was sind die größten Schwierigkeiten beim Übersetzen aus dem Estnischen? Wie gehst du damit um?
Trotz des oben angedeuteten massiven deutschen Einflusses bleibt Estnisch eine finno-ugrische Sprache, und das heißt, dass einige Dinge wirklich grundsätzlich anders sind. Da die finno-ugrischen Sprachen agglutinierend sind, Endungen also in beliebiger Anzahl an ein Wort angeklebt werden können, entstehen manchmal regelrechte Wortungetüme, die man mühselig auseinanderbröseln muss. Und die Reihenfolge der bedeutungstragenden Elemente ist dadurch bisweilen auf den Kopf gestellt. Auf Mikro- und Makroniveau. Es kann dann estnische Bandwurmsätze von zwanzig oder dreißig Wörtern geben, bei denen in der deutschen Übersetzung das letzte estnische Wort das erste deutsche Wort werden muss. Da kostet es manchmal einfach mehr Zeit, ehe man das alles im wahren Wortsinne „auf die Reihe“ bekommen hat. Phonetisch und lexikalisch sind die Probleme nach meinem Dafürhalten nicht so groß, auch finde ich vierzehn Kasus nicht das Problem, das sorgt für klare Strukturen und Ordnung, aber im morphosyntaktischen Bereich kann’s knifflig werden. Man muss sehr genau hinschauen und behutsam, Schritt für Schritt eine Rohfassung erstellen, ehe man dann in einem nächsten Schritt vernünftiges Deutsch draus macht. Die beiden Schritte müssen sorgfältig voneinander getrennt werden.
Eine andere Schwierigkeit kann sein, dass es im Estnischen kein grammatikalisches Geschlecht gibt und auch nur ein Personalpronomen für „sie“ und „er“. Im Deutschen muss man bei Pronomina und Nomina agentis eine Entscheidung treffen, da hilft es manchmal nur, bei Autor oder Autorin nachzufragen. Häufig lautet die Antwort dann: „Ach, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das spielt keine Rolle. Mach, was du willst, ist mir egal.“ Dann muss ich selbst entscheiden, ob es eine „Lehrerin“ oder ein „Lehrer“ wird!
Was kann Estnisch, was Deutsch nicht kann?
Wie aus meinem letzten Beispiel hervorgeht: Man kann wunderbar ambig bleiben und stundenlang über eine Person reden oder schreiben, ohne deren Geschlecht zu enthüllen. Viele der Genderprobleme des Deutschen gibt es in der estnischen Sprache also nicht (in der Gesellschaft natürlich schon), das schafft grandiose Möglichkeiten.
Im Estnischen können auch Substantive gesteigert werden. Jemand kann ein Freund sein, jemand anders kann aber „Freunder“ sein, also noch mehr Freund oder ein besserer Freund. Das geht auch mit Zeit- und Ortsbestimmungen.
Überhaupt ist das Estnische viel kompakter als das Deutsche, häufig muss ein einziges estnisches Wort mit einem umständlichen Relativsatz wiedergegeben werden. Durch den Vokalreichtum – es gibt neun Vokale, alle können kurz, lang oder überlang sein und sie können sich zu insgesamt 36 Diphthongen zusammentun – und die Kompositionsfreudigkeit gibt es sehr exotisch aussehende Wörter. Beispielsweise aoaegne, das ist ein Adjektiv und bedeutet ‚zur Zeit der Morgenröte‘, oder, noch schöner, aoeelne, das heißt ‚die Zeit vor der Morgenröte betreffend‘. Hübsch ist auch jääajajärgne, ‚nacheiszeitlich‘. Der Vokalreichtum führt natürlich auch dazu, dass man die Sprache schön singen kann, und das tun die Esten bekanntlich auch ganz gerne.
Außerdem ist die Wortstellung freier als im Deutschen mit seiner strengen Verbzweitstellung. Auch im Estnischen gibt es zwar durch den deutschen Einfluss eine Vorliebe für das Verb an zweiter Stelle, aber es sind doch auch andere Reihenfolgen möglich. Das sorgt, insbesondere in der Lyrik, für einen viel größeren Handlungsspielraum hinsichtlich Metrik und Reim. Wenn man das dann ins Deutsche transportieren will, kann man enorme Probleme bekommen.

Wir suchen für die Rubrik „Große kleine Sprache“ Übersetzerinnen und Übersetzer, die Lust haben, ihre „kleine“ Sprache mit unserem Fragebogen vorzustellen. Wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich gerne unter redaktion@tralalit.de.