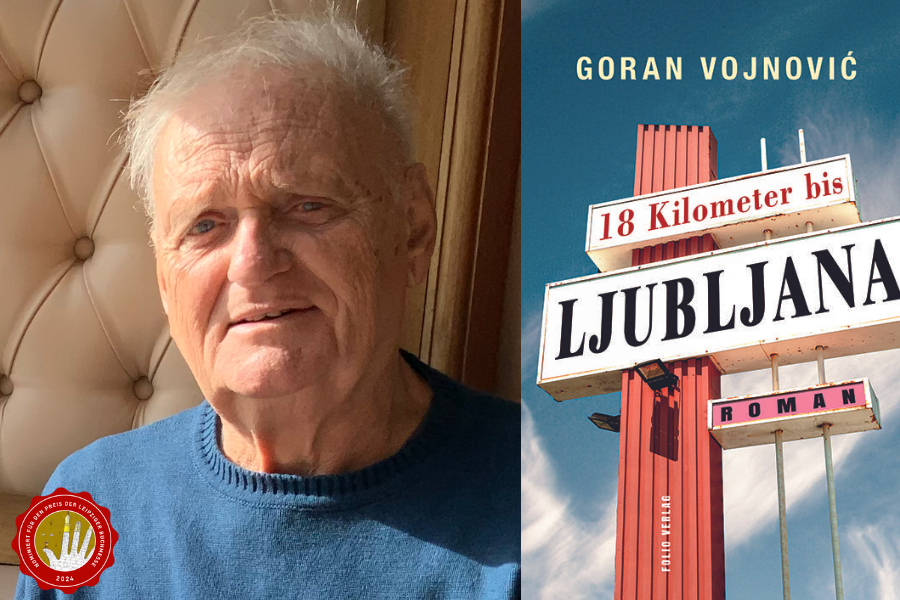In der Reihe „Mein erstes Mal“ berichten Übersetzer:innen von ihrer ersten literarischen Übersetzung. Sie plaudern aus dem Nähkästchen, berichten von den Leiden des jungen Übersetzer:innenlebens und verraten, in welche Falle man als Anfänger:in bloß nicht tappen sollte. Alle Beiträge der Reihe sind hier nachzulesen.
Dass ich Übersetzerin wurde, war nicht vorgesehen. Ich habe Philosophie und Germanistik auf Lehramt studiert und 1980 auch das Erste Staatsexamen gemacht, aber der Professor, bei dem ich danach eine Assistentenstelle hatte, drängte mich dazu, eine Dissertation zu schreiben und im Grunde gleich die Habilitation hinterher. Wenn ich das gemacht hätte, wäre ich heute wahrscheinlich an der Uni in Hamburg Professorin. Das war mir viel zu stark vorgezeichnet, ich dachte nur: „Oh Gott, schnell weg hier!“
Also ging ich nach Italien, denn während einer Klassenreise nach Rom im letzten Schuljahr hatte ich mir geschworen, hier noch einmal hinzufahren. In Rom hatte ich von Anfang an sehr viel Glück. Mein Vater war in einem katholischen Akademikerbund, und in dessen Mitgliederverzeichnis fand ich einen Herrn Kusch in Rom. Herr Kusch, mit dem mein Vater sogleich Kontakt aufnahm, war Präsident der Stampa Estera, also der ausländischen Presse, und hatte zufällig eine Wohnung frei, weil seine Mutter gerade ins Heim gekommen war. Diese Wohnung in einem fantastischen Stadtteil von Rom, auf einem der Hügel, dem Monte Mario, stellte er mir mietfrei zur Verfügung.
Und nicht nur das: Ich wurde auch gleich in die deutschen Kreise in Rom – eine deutsche Frauengruppe, das Goethe-Institut, die Villa Massimo und die kunsthistorische Bibliothek Hertziana – eingeführt. Von diesen Institutionen habe ich dann ziemlich schnell auch kleine Übersetzungsaufträge bekommen. Vielleicht erschien ich durch mein Germanistikstudium fürs Übersetzen qualifiziert. Man fragte mich, ob ich z.B. Texte für Programmhefte und Einladungen übersetzen könne, und ich wagte den Versuch. Im Grunde waren das meine „ersten Male“, aber natürlich noch keine literarischen Übersetzungen.
Dabei konnte ich zu dem Zeitpunkt noch kaum Italienisch. Ich hatte zu Hause in Hamburg einen Kurs an der Uni gemacht und mir bessere Kenntnisse durchs Sprechen bzw. als Deutschlehrerin in Rom beigebracht. Natürlich habe ich auch durch das Übersetzen viel gelernt.

Und so kam wohl auch Emilio Garroni, Philosophieprofessor an der römischen Universität „La Sapienza“, 1989 auf mich. Ich weiß nicht, wer mich ihm empfohlen hat, aber wahrscheinlich hat er in all diesen deutschen Institutionen herumgefragt. Jedenfalls meldete er sich eines Tags bei mir und sagte, er würde gerne sein Buch Senso e Paradosso ins Deutsche übersetzen lassen. Ob ich mir das zutraute? Er lud mich – er war damals schon betagt, aber noch nicht emeritiert, und er war ein außerordentlich freundlicher Mensch – in seine Wohnung in einem wunderschönen Viertel ein. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe nie wieder so viele Kunstwerke in einer Wohnung gesehen. In seinem Buch geht es um Ästhetik, und offenbar war er auch privat ein Kunstliebhaber.
Senso e Paradosso ist ein sehr wichtiges Buch für ihn gewesen, sein Opus Magnum, könnte man sagen. Was er damit wollte, verstehe ich heute nicht mehr so genau. Er versuchte, den Sinn der ästhetischen Erfahrung transzendental zu begründen – also nach Kant die Bedingung der Möglichkeit für ästhetische Erfahrung herauszuarbeiten. Aber wie er genau argumentiert hat, weiß ich heute nicht mehr.
Als ich den Auftrag angenommen hatte, kam er mit einem der allerersten Apple- Computer in meine Wohnung, stellte ihn auf den Tisch und sagte: „So, damit schreibst du.“ Für mich war bis dato eine elektrische Schreibmaschine das höchste der Gefühle gewesen, aber er hat mich dann in die Arbeit mit einem Computer eingeführt. Damals war das allerdings noch ein Abenteuer. Das gesamte Betriebssystem befand sich auf einer Floppy Disk. Weil der Speicherplatz des Computers dafür nicht ausreichte, musste man es vorher laden. Und man durfte diese Floppy Disk nicht herausziehen, ohne das Geschriebene vorher zu speichern, sonst war alle Arbeit verloren. Manchmal hat mein Sohn, damals fünf Jahre alt, an diesem Computer, dessen Bildschirm grüne Zeichen auf schwarzem Grund zeigte, U‑Boot-Kapitän gespielt.
Aber das waren nur die technischen Hardware-Herausforderungen. Man muss sich vorstellen, das war Ende der 80er Jahre, es gab keine Recherchemöglichkeiten im Internet. Und ich besaß noch kein großes italienisch-deutsches Wörterbuch, musste also mit Listen der Wörter, die ich nicht kannte, ins Goethe-Institut oder in die Nationalbibliothek gehen und dort recherchieren. Garroni zitiert in seinem Buch viele deutsche und auch amerikanische Philosophen. Da musste ich zum Teil in Hamburg bei ehemaligen Kommilitonen nachfragen und um die Originalzitate bitten. Das alles per Telefon oder Brief. Die schnellste Verbindung wäre ein Faxgerät gewesen, aber das hatte ich nicht. Technisch und organisatorisch war das Ganze also ein ziemlicher Aufwand.
Aber für die Zeit der Übersetzungsarbeit war das eben auch mein Job und kein Hobby. Der Autor hat mich aus eigener Tasche bezahlt. Es waren ungefähr eine Million Lire im Monat, also ca. 1.000 Mark, aber davon konnte man damals ganz gut leben. Von Normseiten und Recherchezuschlägen hatte ich natürlich noch nichts gehört.
Das Schreiben selbst hat mir viel Spaß gemacht. Ich empfand es als sehr kreativ. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich irgendwann mal verzweifelt wäre. Ich kam ja damals direkt aus dem Philosophiestudium, hatte den ganzen begrifflichen Apparat noch parat. Vor allem auch Kants Kritik der Urteilskraft und Hegels Ästhetik um die es in dem Buch geht. Überhaupt hatte mein Philosophiestudium unter dem Vorzeichen der Ästhetik gestanden. Deswegen war das schon auf mich zugeschnitten.
Was mich allerdings befremdet hat, war Garronis Stil. Ich habe mich über seinen Plauderton gewundert, wenn er beispielsweise schreibt:
Ci siamo subito imbattuti in una difficoltà curiosa. E, certo, non varrebbe la pena di perderci troppo tempo dietro, se essa fosse soltanto una difficoltà terminologica-definitoria o psicologica, attinente al modo di essersi formata di una corporazione culturale, e in quanto questa dovrebbe dar conto del proprio statuto a chi non vi appartiene. Ma la difficoltà è meno esterna di quanto non sia apparso di regola finora. ‚Di regola‘, ma non senza eccezioni e suggerimenti più interni: e anzi più volte ho tentato di far vedere, come in trasparenza, l’emergere di un non banale paradosso dell’estetica.
Wir sind sofort auf eine seltsame Schwierigkeit gestoßen. Und es würde sich sicher nicht lohnen, allzu viel Zeit damit zu verlieren, wenn es sich nur um eine terminologisch-definitorische oder psychologische Schwierigkeit handeln würde, die zusammenhängt mit der Entstehungsweise einer kulturellen Körperschaft und deren Problem, Nicht-Mitgliedern über die eigenen Statuten Rechenschaft abzulegen. Die Schwierigkeiten sind jedoch weniger äußerlich als sie in der Regel bisher erschienen. ‚In der Regel‘, aber nicht ohne Ausnahmen und Anregungen durch die Sache selbst. Ich habe sogar mehrmals zu zeigen versucht, wie durch das Gesagte hindurch ein nicht banales Paradox der Ästhetik hindurchscheint.
Damals dachte ich, dieses rhetorische Brimborium sei vielleicht der Stil der italienischen Philosophie. Inzwischen weiß ich: Das ist der italienische Stil überhaupt. Ich bin oft genug in Diskussionen geraten, in denen ich zu den anderen gesagt habe: „Sagt doch mal wirklich etwas, wozu ihr steht! Nicht nur immer dieser riesige Floskelapparat!“ Die Reaktion war dann oft: „Non fare la Teutonica!“ Aha, als Teutonin nahm man mich wahr. Na gut, dann war ich eben teutonisch. Man lernt auf jeden Fall das Eigene besser kennen, wenn man länger dem Fremden ausgesetzt ist.
Als Übersetzerin würde ich heute anders mit dem Text umgehen. Damals dachte ich, es sei meine Aufgabe, diesen Stil zu bewahren. Es wäre mir auch überhaupt nicht in den Sinn gekommen, daran etwas zu ändern.
Ich kannte auch die idiomatischen Wendungen im Italienischen nicht genau genug. Wenn er zum Beispiel schreibt: „Ammesso e non necessariamente concesso che la poesia sia una sorta di mistero linguistico“ – ganz wörtlich übersetzt: „Angenommen, aber nicht zugegeben …“ -, dann ist das eine Floskel, die nichts anderes besagt als einfach: „angenommen“. Stattdessen schrieb ich: „Nehmen wir einmal an, ohne es damit unbedingt zuzugeben …“ Das ist noch schlimmer als im Original! Da bin selbst in Garronis Plauderton hineingerutscht. Der Satz müsste einfach lauten: „Nehmen wir einmal an, die Dichtung sei eine Art sprachliches Geheimnis.“ So würde ich das heute übersetzen.
Das Buch ist 1991 in meiner Übersetzung – übrigens komplett unlektoriert – im Verlag Peter Lang erschienen. Das war also mein „erstes Mal“ – in vielerlei Hinsicht ein besonderes Debüt für eine Übersetzerin. Einen Durchbruch in Deutschland hat Garroni damit nicht erzielt. Ein paar Kollegen, deutsche Philosophen, kannten ihn, aber bekannt ist er bis heute nur in Italien.
Für mich war das der Einstieg in einen Beruf, der damals noch immer nicht der meine war. Ich habe das als Gelegenheitsarbeit betrachtet, der ich nebenbei nachgehen konnte, auch nach meiner Rückkehr nach Deutschland. Zurück in Hamburg bin ich in ein Graduiertenkolleg eingetreten, um doch noch meine Promotion zu schreiben. Passenderweise trug dieses Graduiertenkolleg den Titel „Ästhetische Erfahrung”. Und meine Promotion hatte den Titel „Beim Wort nehmen. Sprachphilosophische und ästhetische Probleme der literarischen Übersetzung“. Da hatte ich also schon Feuer gefangen.
Aber meine berufliche Zukunft sah ich immer noch in der akademischen Welt. Wäre eine meiner zahlreichen Bewerbungen auf Habilitationsstellen erfolgreich gewesen, dann wäre ich wohl nie in den VdÜ eingetreten und nie hauptberufliche Übersetzerin geworden. Aber 1998 erhielt ich den Übersetzungspreis der Hamburger Kulturbehörde, und da dachte ich mir, so schlecht könne ich als Übersetzerin wohl nicht sein. Zwischen meinem „ersten Mal“ und dem Einstieg in das Übersetzen als Hauptberuf lagen also zehn Jahre, allerdings auch schon eine Reihe Übersetzungen.
2024 ist Italien wieder Gastland der Frankfurter Buchmesse – zum ersten Mal seit 1988, als ich meine ersten Übersetzungsaufträge bekam. Jetzt habe ich alle Hände voll zu tun. Aber bald ist es auch mal gut. Ich übersetze seit über dreißig Jahren, inzwischen um die 100 Bücher, und bekomme 466 Euro Rente im Monat. Die Arbeit der Übersetzerinnen und Übersetzer wird nicht angemessen bezahlt – das kann man gar nicht oft genug betonen.
Zum Abschluss vielleicht ein Tipp für alle, die mit Sachbuchübersetzungen in den Beruf einsteigen wollen: Löst euch unbedingt vom Original! Auch vom Satzbau. Bei Sachbüchern geht es darum, die Idee, den Gedanken, der im Satz steckt, zu erfassen und in ein gutes, lesbares Deutsch zu bringen. Wenn man einen Satz nicht gelöst kriegt, wenn da unüberwindliche Übersetzungsprobleme auftauchen, dann steckt meistens ein Denkfehler im Satz des Originals. Da ist dann Interpretation gefragt.