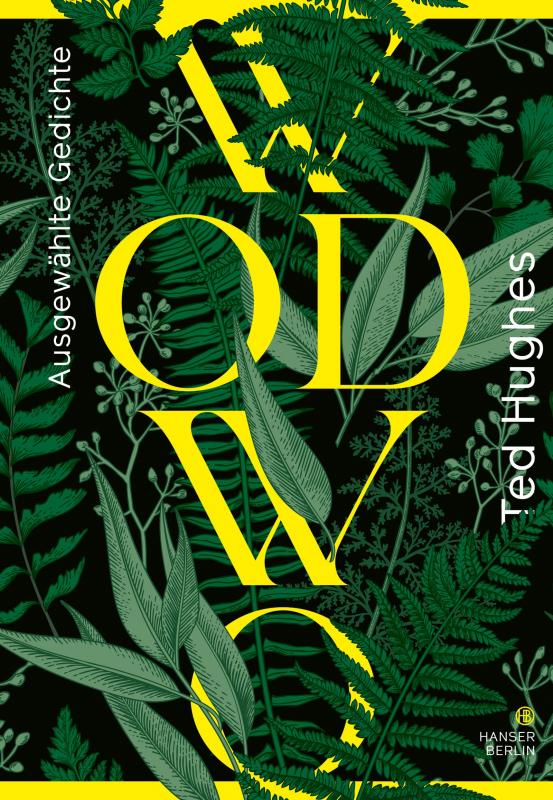Ich war sehr neugierig auf Jan Wagners Übersetzung von Ted Hughes. Denn ich malte mir ein großes literarisches Drama aus, dessen Ausgang mir völlig ungewiss schien: Jan Wagner, selbst ein arrivierter Dichter, übersetzt Ted Hughes. Hughes, den Kritiker aufgrund der Qualität seines Werks mit Sätzen á la: „Einer der wichtigsten britischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts“ schmückten. Er war berühmt, wurde viel gelesen, löste Skandale aus und entwickelte einen prägnanten Stil, den man schon nach wenigen Verszeilen erkennt. Besonders spannend an der neuen Übersetzung durch Jan Wagner finde ich Folgendes: Das Werk des Übersetzers erscheint mir durch und durch von einer Freundlichkeit und Besonnenheit geprägt, von Humor, Verspieltheit und Ironie. Sogar ein Gedicht, das sich inhaltlich um eine Kaimanjagd dreht, kommt ohne Blut, ohne Tod aus – zumindest ohne es direkt anzusprechen – das Schaurige wird in Metaphern verpackt: Messer sind dazu da, dem Tier „aus dem anzug zu helfen …“ und am Ende wird Mord und Totschlag nur angedeutet: Die Flinte zielt ins Dunkel zwischen zwei Sterne.
Ob diese Aussparungen nicht viel kunstfertiger und gruseliger sind als mörderische Details zu präsentieren, sei dahingestellt. In Wagners Gedicht bleibt der Welt und der Natur ihr Zauber; seine lyrischen Expeditionen ins Tierreich gehen zumeist gut für uns aus. Hughes hingegen erspart uns nichts – im Gegenteil: Er scheut keine Mühe uns mit der Nase voran ins noch warme Blut zu tunken. Während Wagner vermag, eine eher friedliche Kaimanjagd zu dichten, schafft es Hughes, ein Gedicht über Lachseier zu einem furchterregenden Erlebnis zu machen. Das machte mich wirklich neugierig: Was ist das Ergebnis, wenn ein Dichter einen anderen übersetzt, dessen Temperament so völlig unterschiedlich vom eigenen ist? Wie wird Wagner Gedichte von Hughes mit klingenden Namen wie „The Dogs Are Eating Your Mother“ übersetzen? Nun, im Fall dieses Gedichts werden wir es wahrscheinlich nie erfahren, denn er hat es nicht übersetzt. Das Gedicht hat es nicht ins Buch geschafft. Die gruseligen Lachseier auch nicht.
Nun, das was Wagner übersetzt hat, weist jene geschmeidigen Rhythmen und Verse auf, die auch seine eigenen Gedichte auszeichnen. Was Wagner da übersetzt hat, liest sich gut. Irritiert bin ich erst, wenn ich auf die Nebenseite blicke und parallel Hughes’ Original lese – dieser Zweifel an der Übersetzung im Angesicht des Originals ist nicht ungewöhnlich. Jeder Mensch, der schon mal übersetzt hat, weiß, dass man die Ursprungsgedichte neuschreibt, ihnen eine neue Stimme, neuen Klang, neue Sprache verleiht, verleihen muss. Übersetzen erinnert in dieser Hinsicht an Kartografie, bei der die reale, dreidimensionale Welt nicht verlustfrei auf zweidimensionales Papier übertragen werden kann. Beispielsweise ist Grönland an der Fläche gemessen fast genau sogroß wie Saudi Arabien, obwohl auf fast jeder Karte Grönland um ein Vielfaches größer dargestellt ist – das passiert eben, wenn man einen runden Planeten auf einer flachen Karte übertragen will. Gedichte von einer Sprache in andere übersetzen ist wie eine Kugel zu einer Fläche machen. Eine Übersetzung ist nie deckungsgleich mit dem Original. Der Dichter Robert Lowell hat in diesem Sinne seine Übersetzungen stets Imitationen genannt.
Zudem bin ich auch geneigt, in diesem Fall den Fehler erstmals bei mir selbst zu suchen. Denn ich bin ich insofern ein schwieriger Kunde, da Deutsch und Englisch bei mir sehr unterschiedliche Assoziationen auslösen, weil beide Sprachen sehr intim und sehr unterschiedlich mit meiner Biografie verbunden sind – so ehrlich muss ein Kritiker sein, das spielt eine Rolle. Englisch ist die Sprache meines Vaters, die Sprache meiner frühen Kindheit, meiner Verwandten im Norden Englands, meiner verstorbenen Großmutter; die Sprache einer größeren Welt; eine zweite Muttersprache, in der ich ein anderer Mensch sein kann, anders denke, anders fühle; die Sprache Londons, wo ich studierte; eine Sprache, die für mich immer gefährdet ist, weil ich in Österreich lebe und ich Angst habe, dass ich sie verliere, obwohl sie Teil meiner Identität ist – das ist Englisch.

Und Deutsch? Das ist die Sprache meines Alltags, meiner Stadt, meines Berufslebens und die Sprache, in der ich selbst schreibe und Kaugummi kaufe. Und von welchem Deutsch sprechen wir eigentlich? Denn ich lebe in Wien, in Österreich. Das Deutsch, das ich in Wien spreche, unterscheidet sich von dem Deutsch des Hamburgers Jan Wagner. Bin ich irritiert, wenn ich Wagners Imitationen lese, weil er mit seiner deutschen Sprache in einen, für mich, unantastbaren Kindheitsraum der englischen Sprache schreitet, der mir heilig ist? Und das noch dazu in einer Variation des Deutschen, also dem Deutsch Norddeutschlands, das mir fremd vorkommt, das andere Ausdrücke verwendet, andere grammatische Neigungen hat? Aus dieser Perspektive heraus wundert es mich nicht, dass es mir eher schwer fällt, mich an seinen Imitationen zu erfreuen, obwohl ich an deren Oberfläche erstmals kaum einen Makel entdecke.
Aufgrund meiner möglichen Vorurteile werde ich mir nun doppelt Mühe geben müssen, transparente Kriterien für meine Analyse zu finden. Dies halte ich sowieso für notwendig. Wenn wir fragen, ob eine Imitation erfolgreich war, müssen wir vorher fragen, was überhaupt übersetzbar ist, denn die Sprache selbst, wie ich schon feststellte, bleibt beim Original. Als ersten Schritt finde ich es sinnvoll, darzulegen, welchen Anspruch sich Jan Wagner selbst ans Übersetzen gesetzt hat. Am Ende des Bandes macht er die Eckpunkte transparent: Er verweist auf die Poetik von Hughes, dass Gedichte wie wilde Tiere seien, die ein Eigenleben haben. Somit achtete er darauf: „ihnen nicht nachträglich, durch das Auswildern in einen anderen Sprachraum Leid zuzufügen“. Nach einer „Phase der philologischen Gründlichkeit“ galt es mit möglichst „Hughes’scher Verve lebendige deutsche Wesen zu schaffen…“. Es gäbe eine „übersetzerische Treue“, an die er gebunden sei und gleichzeitig machen gewisse semantische oder formale Aspekte der Originale freiere Übersetzungen nötig.
Den Anspruch Wagners fasse ich so zusammen: Möglichst treu übersetzen, möglichst durch die Energie von Hughes beseelt und gleichzeitig gilt es, eigenständige, funktionierende Gedichte zu schaffen. Wie gehen wir nun weiter vor? Wir könnten nun aufwendig analysieren, inwiefern Wagner seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Bleibt er dem Original treu, wo es notwendig ist? Schafft er lebendige lyrische Wesen? Dabei stoßen wir aber auf folgendes Problem: Angenommen, wir wittern an gewissen Textstellen, dass Wagner sich dem Original gegenüber untreu verhalten hat, etwa weil er gewisse Worte nicht wortwörtlich ins Deutsche übersetzte – woran können wir festmachen, dass er damit eine schlechte Entscheidung traf? Dabei ergeben sich mehr Fragen: Was gilt es überhaupt zu übersetzen? Übersetzen mit welchem Ziel?
Eines ist hierbei relevant: Jan Wagner hat nicht bloß Gedichte, oder die Gedichte von Hughes übersetzt, er hat einen Auszug aus seinem Werk übersetzt, nicht einen Einzelband. Und ein poetisches Werk ist mehr als die Summe seiner Gedichte. Wagner stand vor dem Problem, auswählen zu müssen, was er übersetzte, nicht bloß zu übersetzen; also, wie er das (englische) Gesamtwerk so reduzierte, dass es in reduzierter (deutscher) Form noch immer das Werk von Ted Hughes ist. Wagner stellt klar, wie er die Gedichte für den Band auswählte: „Ich gebe freimutig zu, als Bewunderer ganz den eigenen Vorlieben gefolgt zu sein; dennoch scheint mir die Auswahl repräsentativ für das lyrische Schaffen von Ted Hughes zu sein.“ Ich bin der Meinung, dass Wagners Zugang, Gedichte nach den eigenen Vorlieben auszuwählen, in diesem Fall nicht der ideale Zugang war.
Wagner ließ das liegen, was ihm nicht gefiel – oder war es in diesem Fall, was ihm nicht behagte? Denn wie schon erwähnt, diese zwei Dichter, Wagner und Hughes, unterscheiden sich stark voneinander. Aber in welcher Hinsicht genau? Hughes und Wagner unterscheiden sich hinsichtlich ihrer poetischen Vision – und darauf möchte ich hinaus. Die poetische Vision ist der Succus, der dem Werk seine Kraft verleiht. Die poetische Vision ist auch das, was wirklich Treue von Übersetzerinnen verlangt. Was Hughes’ poetische Vision ausmacht, ist leicht feststellbar, da er viel darüber geschrieben hat, und vor über zwanzig Jahren starb; sein Werk beschloss er mit seinem Tod (während Wagners poetische Vision noch lebt und wächst). Mit poetischer Vision meine ich zweierlei: Einerseits umfasst sie, was und wie die Welt von der Dichterin gesehen wird, sowie (implizit) wie sie sein soll. Andererseits gibt diese Vision auch über den Zweck des eigenen Dichtens Auskunft: Wenn die Welt so und so ist, welchen Einfluss hat Dichtung darauf?
Wagner hat also die Gedichte von Hughes nach den eigenen Vorlieben ausgewählt. Ich beharre darauf, dass die Grundlage für diese Auswahl aus dem Werk, sowie für die ganze Übersetzung-Imitation, die poetische Vision der Künstlerin sein sollte. Ich halte das für wichtig. Nicht bloß, weil wir das den Autorinnen schuldig sind. Ich halte es aus anderen Gründungen für wichtig: Die voll ausgedrückte poetische Vision ist das, was für die Gesellschaft am Werk am nützlichsten ist. In der poetischen Vision steckt das, was wir kollektiv für einen Nutzen an Dichterinnen haben. Nur damit das klar gesagt ist: Kaum eine Dichterin setzt sich hin und formuliert die eigene Vision als solches aus, sodass sie dies als Leitfaden des eigenen Schaffens verwenden kann – das würde den eigenen kreativen Tod bedeuten, abgesehen davon, dass ich solch eine Reflexion für unmöglich halte. Genauso überlegen Künstlerinnen sich nicht, welchen Zweck die eigene Kunst hat, denn was mit Zweck geboren wird, kommt in Ketten auf die Welt und Kunst muss frei sein. Den Nutzen eines Werkes können wir als Leserinnen, wir als Gesellschaft, hochheben und feiern: Ja, das ist gut, das ist wichtig an diesem Werk! Von dem wollen wir mehr. Das wollen wir fühlen, das wollen wir schaffen! Hier entsteht also ein Spannungsfeld zwischen dem (unartikulierten) Nutzen eines Werkes und der gesellschaftlichen Nutzbarmachung; der Nutzen muss aber dennoch plausibel im Werk verankert sein und dem entsprechen, was die Künstlerin schuf, weil es sonst wirkt wie substanzloses Marketing, also gar nicht.
Wie auch Wagner in seinem Essay am Ende des Bandes feststellt, war Hughes’ Lyrik in der natürlichen Welt verankert. Er schrieb von Krabben, Mauerseglern, Mooren, usw. Wie auch Wagner betont, macht dies Hughes aber nicht zum Naturdichter, er sei eher ein „Hymniker eines ungebändigten, kraftvollen, erdnahen Seins“. Hughes war ein Umweltschützer erster Stunde. In einem Essay aus 1970 beklagt er, dass die Mäuse im Feld dem Universum lauschen, den Gesetzen des Kosmos folgen, in dem alles voneinander abhängig sei, während der moderne Mensch Felder bemisst, um darauf Immobilien zu stellen, weil die Aktienbesitzerinnen auf ihre Dividende warten. Wir haben uns der Welt bemächtigt und kümmern uns nicht uns sie. Wir sind blind für das wahre Leben auf unserem Planeten geworden. Diese Sensibilität von Hughes spiegelt sich gut in der Auswahl Wagners wider. Wo die Visionen der Naturwelt bei Hughes und Wagner auseinanderklaffen, ist beim Thema Gewalt: Für Hughes ist Gewalt ein inhärenter Teil des Naturgeschehens, des „göttlichen Gesetzes“ das erschafft und zerstört, Tiere macht und sie verenden lässt. Gewalt ist fundamentaler positiver wie negativer Teil von dem, wie unser Kosmos funktioniert, wovon wir Menschen als Naturwesen nicht ausgenommen sind. Aber wir Menschen verdrängen das, stattdessen haben wir ein oberflächliches Verständnis von dieser waltenden Macht bekommen. Mit unserer naturfernen Art zu leben, berauben wir uns eines Lebens, das in die Natur, unserer Natur, eingebettet ist.
Wagners Auswahl findet Platz für Hughes’ Gedichte über Jaguare, Otter, Hechte, Bären, aber in Summe liest sich das wie eine Auswahl klassischer Naturgedichte. Mir fehlen ambivalente Gedichte wie zum Beispiel „Horses“, in dem Hughes von Pferden im Morgenfrost schreibt, wobei er unvermutet eine „bösartige Luft“ in dem Wunder wahrnimmt, das uns umgibt; mir fehlt „The River“, das beginnt mit: „Vom Himmel gefallen, liegt er / im Schoß seiner Mutter, durch die Welt gebrochen.“ Wagner übersetzte das Gedicht über ein neugeborenes Kalb; aber jenes, wo Kälber von den Müttern getrennt werden und die Kleinen verloren auf der Wiese stehen; oder jene, wo Kälbern die Hörner abgeschnitten werden, sodass Blut über ihre Wangen rinnt; oder das Gedicht über das missbildete Lamm, das seine erste und einzige Nacht nicht überlebt – jene und viele andere, die von Hughes’ fundamentalem Grauen durchtränkt sind, wurden nicht aufgenommen. Solche Gedichte irritieren beim Lesen, genauso wie andere beängstigend oder beklemmend sind. Als Herausgeber wird man vielleicht gedacht haben, dass dies nichts für die angepeilte Leserschaft sei, denn man möchte doch die Menschen erfreuen, nicht bedrücken – aber genau das kritisierte Hughes an unserem Naturverständnis: Wenn Natur süß und flauschig ist, mögen wir sie, da fühlen wir uns mit ihr verbunden; wenn sich die Tiere gegenseitig Eingeweide herausreißen, dann sind wir plötzlich stolz auf unsere friedliche Zivilisation – dass wir uns hier selbst belügen, ist uns allen klar, denn wir friedlichen Menschen betreiben soeben das größte Artensterben dieses Planeten seit dem Verenden der Dinosaurier.
Natürlich: Das sind einzelne Gedichte, die ich hier beanstande und – wer weiß? – vielleicht fühle ich mich hier bloß in meinen Vorlieben gekränkt. Aber wirklich schmerzlich und verzerrend erscheint mir, wie wenig von Hughes’ Meisterwerk, Crow, in diesem Band vorkommt. Nach dem Selbstmord von Sylvia Platz bündelte Hughes alles, was Dunkel an seiner Seele war, in den Gedichten, die von einem Tier-Mensch-Gott-Todesengel, von Crow, handeln. Wagner wählte drei Crow-Gedichte für seinen Band aus. Hughes hingegen wählte mehr als dreißig davon für seine letzten Ausgewählten Gedichte aus, in denen sie eine zentrale Stellung einnehmen. Diese Gedichte sind berührend, erschütternd und grausam. Sie handeln von diesem mörderischen Krähenwesen, bei dem sogar Gott persönlich daran scheiterte, es wieder zur Liebe zu bekehren; Crow erinnert sich noch taub und dunkel daran, wie es einst war, geliebt zu werden. Weil Crow nicht mehr lieben kann, führt es jetzt dem ganzen Universum, Trauer, Dunkelheit, Tod und Schmerz zu – ein Psychogramm aus (männlicher) Schuld, Angst, Trauer und Gewalt. Innerhalb von Hughes’ Gesamtwerk stellt dies einen schlüssigen Höhepunkt dar, wenn man bedenkt, dass er uns an die gewalttätige Kehrseite allen Lebens erinnern will. Aber wenn man solche Gedichte neben eine Auswahl klassischer Tiergedichte stellt, dann wirken diese Gedichte eher befremdlich und fehl am Platz. Ein Gedichtband, der Crow aufnehmen und halten kann, hätte sich näher an Hughes’ Vision einer gnadenlosen, aber wunderschönen Welt der Pflanzen und Tiere orientieren müssen, dessen Dunkelheit und Schönheit sich in unserer eigenen Seele widerspiegelt.
Hughes’ archaisches Weltbild schlug sich auch auf seine Poetik nieder, nicht bloß auf seine poetischen Inhalte. Die Sehnsucht nach einer menschlichen Existenz, die ins volle Leben der Natur integriert ist, lässt ihn weit in die Vergangenheit zurückblicken, auf der Suche nach vormodernen poetischen Vorbildern. Vor allem altenglische Dichtung fand er in diesem Kontext interessant. Zu dieser Zeit wurden Gedichte, laut Hughes, noch nicht mit dem Metronom starrer Metrik geschrieben; Hebungen und Senkungen folgten natürlichen Sprachrhythmen. Diese freiere Metrik beruhte stark auf Alliteration, welche den Lesenden half, die richtigen Silben zu betonen. Diese lyrische Tradition sei lange ignoriert worden und kam erst wieder mit Gerard Manley Hopkins Ende des 19. Jahrhunderts zum Vorschein. Hier ein Beispiel von Hopkins, welches das Zusammenspiel von Alliteration und Betonung veranschaulicht: „I caught this morning morning’s minion, king-/dom of daylight’s dauphin, dapple-dawn-drawn Falcon, in his riding …“ Hughes’ berühmtes Gedicht, das Wagner „Gedankenfuchs“ nannte, beginnt mit einer Verszeile, die fast als Ode an Hopkins gelesen werden kann: „I imagine this midnight moments forest“. Was Wagner übersetze mit: „Ich stelle mir den Mitternachtsmomentwald vor“. Das sind Verse, die fast unmöglich in der ursprünglichen Intensität übersetzbar sind. Die Alliteration ist bei Wagners Imitation insofern gewahrt, da Betonungen und M‑Laute zusammenfallen.
Hughes hatte ein sehr feines Ohr für die Laute seiner Gedichte und wie diese mit Inhalten verknüpfbar sind, um bestimmte Atmosphären zu schaffen. Wie geschmeidig machen die Assonanzen der I‑Laute den Vers dieses Gedichts! Dazwischen knurren und hauchen Ms, Ds, Gs. Die Geräusche, die dieser Vers macht, passen für mich sehr gut zur Szenerie eines stillen Moments der Mitternacht im Wald. In diesem Gedicht gibt es mehrere Beispiele dieser Art, „though deeper within darkness“, etwa. Was Wagner imitiert mit: „sich tiefer verbirgt im Finstern“. Die Übersetzung-Imitation klingt anders, evoziert anders. Die Stimme von Hughes geht bei Wagner verloren. Dass hier jede Übersetzerin an Grenzen stößt, das hier Übersetzen per se an Grenzen stößt, wird an solchen Beispielen evident. Oftmals gibt Wagner diese Alliterationen wider, jedoch die ausgeklügelte Klangkulisse von Hughes’ Gedichten ist schwierig zu imitieren – vor allem, wenn die anderen Aspekte eines Verses transponiert werden sollen, allen voran der Sinn. Den Klang-Rhythmik-Komplex von Hughes’ Gedichten ins Deutsche heben, stößt an eine weitere Barriere: Hughes verwendete fast durchgängig Worte mit ein oder zwei Silben, die er, wie vorher besprochen, mit den Hebungen und dem Klang, oftmals auch mit dem Sinn des Gedichts verwurzelte. Verse mit ein‑, oder zweisilbigen englischen Wörtern schreiben, ist nicht so schwer – im Deutschen ein Oeuvre aus größtenteils zweisilbigen Wörtern zu schaffen, ist höchsten für eine Dadaistin denkbar.
Aber Hughes gefiel noch mehr an der altenglischen Dichtung: dass sie sich an „common speech“, an der Alltagssprache orientierte. Im Gedicht „Rehe“ schreibt Hughes: „The moment I was arriving just there.“ – Was alltäglichem Englisch entspricht. Wagner dichtet: „Just als ich dort ankam“. Das erscheint mir, mit österreichischen Ohren wohlgemerkt, kein alltäglicher Sprachgebrauch. Genauso wenig kann ich mir vorstellen, dass zwei Bäuerinnen oder zwei Büroangestellte die folgenden Wörter verwenden: emporschleudern, entfachen, zerschellen, aufwehen, verdrießen und bestirnen – die allesamt verständliche und interessante Dichter-Worte sind, aber nicht Alltagssprache. Obwohl man Hughes hier selbst Widersprüchlichkeit vorwerfen kann, da er teilweise eine komplexe Sprache verwendete (Dichtung für den „einfachen Mann“ schreiben, ist mir aus mehreren Gründen suspekt).
Dennoch verstehe ich nicht, wieso, beispielsweise, aus einem recht platten „We came…“, von Hughes, bei Wagner ein: „Gelangten wir…“ werden muss. Hughes schreibt „smashed“, Wagner: „zertrümmertest.“ Aus „Dropped from life“ wird „Herausgestürzt aus dem Leben.“ Hughes beginnt ein Gedicht mit: „In the dawn-dirty light, in the biggest snow of the year“. Wagner beginnt mit: „Im Dämmerungsschmutzlicht, im dichtesten Schnee des Jahres“. Dämmerungsschmutzlicht, Granatsplitterschrecken, Schneeschutzscheibensicht, Stalaktitenlichtreflexe – sind solche Nomen-Haufen wirklich notwendig? Wieso nicht bei der Vorlage bleiben, wie Hughes Adjektive verwenden, und dabei versuchen möglichst die Laute wiederzugeben? „Im schmutzigen Schein der Dämmerung, im dichtesten Schnee des Jahres.“ (Bei meinem Versuch wird der Vers aber überlang und bricht wahrscheinlich sogar in die nächste Zeile, was die Form verändern würde. In diesem Fall, frage ich mich, ob man nicht ein wenig des Sinnes dem Klang opfern könnte, um den Vers abzukürzen: „Im schmutzigen Schein der Dämmerung, im dichten Schnee“.) Nun, ich habe es leicht: Ich bin in der komfortablen Situation auf der Couch zu sitzen und die Arbeit eines anderen zu bewerten. Wagner hat es sich keinesfalls leicht gemacht mit seinen Imitationen. Dennoch frage ich mich, ob eine andere Wortwahl dem Übersetzer oftmals einleuchtender erschienen wäre, wenn die Intention des Autors im Vordergrund gestanden wäre.
Ich habe erwähnt, dass ich der Ansicht bin, dass Dichtung ein gesellschaftlicher Nutzen auferlegt werden kann, obwohl Kunst selbst nicht nützlich ist. Auch Hughes war der Meinung, dass wir der Dichtung eine Funktion geben können. In einem Essay über Mythos und Bildung schilderte er seine Überlegungen: Es sind Mythen und Erzählungen, die uns erlauben, unsere Umgebung mit Sinn zu erfüllen und uns helfen mit Widersprüchen in uns und der Welt leben zu können. Diese Mythen eröffnen uns die spirituelle Dimension unserer Umgebung und von uns Selbst. Dichtung erschließt den Boden unserer Seele, um uns empfänglich für gewisse Erfahrungen zu machen. Dichtung hilft uns zu sehen, zu fühlen und folglich sinnvoll zu handeln.
Diesem Gedanken folgend können wir uns überlegen, welchen Nutzen die poetische Vision Hughes’ für eine deutschsprachige Leserschaft in Mitteleuropa haben könnte. Beginnen wir mit dem, was dringend ist: Wir leben inmitten eines Zeitalters globalen, ökologischen Niedergangs, für den wir Menschen und unsere Lebensweisen direkt verantwortlich sind – Hughes’ Erklärung dafür könnte sein, dass wir unsere Mythen der Werbung und dem Fernsehen entnehmen, nicht der Natur. Diese Erzählungen beschwören uns, Sneakers zu kaufen und Häuser zu bauen. Hughes’ Lyrik kann als Ansporn verstanden werden, uns als mythische Naturwesen zu verstehen und den Ursprung unserer Mythen in der Naturwelt zu suchen; die Ohren zu öffnen und zu hören wie die Tiere und Pflanzen erzählen, sodass wir ihnen wieder ins Dickicht folgen. Die Natur berichtet uns von Erfahrungen, die voller Schönheit und Leid sind und diese Mythen können uns in ein besseres, ehrlicheres Leben führen – zumindest erinnert uns seine Dichtung daran, dass wir solche anderen Wesen sein können und vielleicht sein müssen, um als Spezies das 21. Jahrhundert zu überleben.
Hughes’ Werk hat eine weitere Implikation – für die deutschsprachige Literatur: Denn deutschsprachige Lyrik hat ein Gewaltproblem. Gewalt, sowie fast alles, was unbehagliche Gefühle beim Lesen auslösen könnte, wird als Aspekt und Thema der Lyrik zumeist ignoriert. Als Alternative dazu verstehe ich eine Poesie, die alles Menschliche abbildet, thematisiert und erlebbar macht, auch das Schlechte. Die etwaige Kritik, dass wir so etwas keine Bühne geben sollten, kann ich nachvollziehen. Dennoch frage ich mich, ob wir uns damit nicht in der Literatur einer Verständnis- und Erfahrungsdimension berauben, die nützlich sein könnte. Zu oft trennen wir zwischen „guten“ Gefühlen, die wir hochhalten – gelassen, froh, akzeptierend, klar, usw. – und „schlechten“ Gefühlen: wütend, hasserfüllt, rachsüchtig, gierig, usw. – Gefühle, die wir möglichst schnell loswerden oder zumindest in Anwesenheit anderer nicht ausdrücken sollen.
Die Konsequenz ist leider, dass man nicht bloß einzelne Gefühle unterdrückt, sondern sein Gefühlsleben generell betäubt – man fühlt und empfindet weniger, wenn man nicht auch Hass und Leere empfinden darf. Wie soll man jemals mit seiner eigenen Dunkelheit leben lernen, wenn man sie immer leugnet?! Wir leben in einem Zeitalter der Katastrophen und was spiegelt die deutschsprachige Lyrik davon wider? Angesichts dessen, dass wir am Rande eines Abgrunds taumeln, erscheint mir unsere zeitgenössische Lyrik wie ein harmloser Vergnügungspark, wo man nichts zu befürchten hat, außer nach der Lektüre vielleicht ein bisschen betrübt zu sein. Auch wenn diese Kritik nicht sonderlich differenziert ist – Dichtung sollte differenziert sein! Dichtung sollte das gesamte Spektrum menschlichen Erlebens abbilden. Dichter wie Ted Hughes helfen uns dabei. Ein Dichter wie Hughes verleiht der dunklen Seite unseres Seins Sprache. Hughes betont, dass wir den schwierigen Aspekten unseres Wesens mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Seine Lyrik gibt uns einen Wink, in welche Richtung wir aufbrechen könnten.