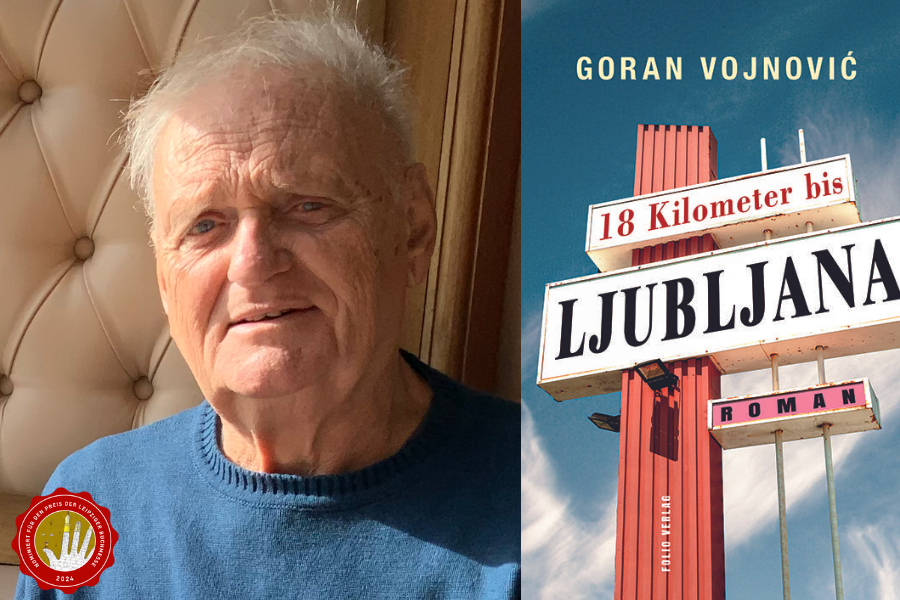In deinem Gedicht „Wörterbücher“ (Sp. Diccionarios), das zugleich der Titel deines 2019 im hochroth Verlag Heidelberg erschienenen Gedichtbandes ist, geht es um Sprache und ihre Fragilität. Welchen Stellenwert haben die Wörter bei dir innerhalb des Entstehungsprozesses eines Gedichtes? An welcher Stelle reißt das Wort auf und wird dem poetischen Raum überlassen mit seinen Leerstellen und Signifikanten?
Trinidad Gan: Ich war schon immer der Überzeugung, dass das Wort wie eine Pupille sein sollte, die sich bei der Berührung mit der Wirklichkeit weitet, und dass die Aufgabe des Dichters darin besteht, wie ein Jäger zu schreiben, immer auf der Suche nach dem Verborgenen. Deshalb lasse ich mich, wenn ich den ersten Entwurf eines Gedichts niedergeschrieben habe, mehr von Bildern als von Ideen inspirieren, von visuellen Spuren, die ich durch Worte auf eine für den Leser suggestive Weise spürbar zu machen versuche.
Wie muss ein Wort beschaffen sein, damit es Aufnahme in deine Gedichte findet?
Jedes einzelne Wort erscheint wie ein Körper. Es atmet, pocht, schweigt und bekommt im Textgewebe sein eigenes Gewicht. Ich verlasse mich auch sehr auf seine Aussagekraft, die die ursprüngliche Quelle der Poesie ist. Ich neige ferner dazu, mir laut vorzulesen, was ich schreibe. Oft überrascht es mich, wenn dabei die semantische Bedeutung vom Wortklang überlagert wird und dabei zur reinen Musik wird.

Beim Lesen dieses Gedichtes bekomme ich immer noch eine Gänsehaut. Ich lese die Zeilen auch als Plädoyer an die Menschlichkeit, sich nicht innerhalb des eigenen Wortschatzes zu verschanzen, sondern Sprache als Mittel zur Überschreitung von Sprachbarrieren zu verstehen, was ein Verständnis jenseits von Wörtern und Sätzen ermöglicht. Was war bei dir der Auslöser, dieses Gedicht zu schreiben?
Abgesehen von der Anekdote, die den Anstoß zu seiner Niederschrift gab (auf einem internationalen Poesietreffen wurde ich durch die Lesung eines mir unbekannten Dichters in einer mir nicht geläufigen Sprache inspiriert), hatte ich während der Lesung das Gefühl, dass der Dichter eine doppelte Identität in sich trägt. Er war Fremder und Zeuge zugleich. Damals dachte ich, dass der Dichter sich selbst und der Welt oft fremd gegenübersteht, und mit seinen Gedichten ein wenig Ordnung sucht im inneren Chaos und darin auch etwas Schönes entdeckt.
Wörterbücher, das sind ja zunächst einmal Hilfsmittel zur Übertragung eines Textes in eine andere Sprache, immer auch mit der Gefahr der Bedeutungsverschiebung, des Missverständnisses. Inwieweit vertraust du der Wirkkraft von Lyrik über den eigenen Sprachraum hinaus, zum Beispiel bei einer Lyrikübersetzung?
Für mich ist die Aufgabe des Übersetzers fast wie die eines Seiltänzers, der gefährlich zwischen zwei Ufern balanciert, die oft zu Abgründen werden. Es ist eine Aufgabe, die ich immer sehr bewundert habe, und deshalb habe ich bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen ich versucht habe, andere Dichter zu übersetzen (vor allem mit meinen begrenzten Kenntnissen anderer Sprachen), große Schwierigkeiten gehabt.
Worin besteht für dich die Faszination einer Übersetzung?
In meinem Buch Papel ceniza (Editorial Valparaíso, 2014) gibt es ein Gedicht mit dem Titel „Traducciones“ (Übersetzungen), in dem ich die Übersetzungen, ausgehend von meinen eigenen Versuchen, als ein Spiel mit Masken definiere, nicht ohne vorher über den Reichtum und das Staunen zu sprechen, das sie mir gebracht haben:
Du durchquerst den Wald der Seiten
und ein Wort, eine erhobene Menge,
bringt die Lippen eines Fremden an deine Lippen.
Wie können wir mit dieser vagen Musik,
die in der Ferne klingt, wie in Träumen, versuchen,
andere Knochen zu durchbohren, anderes Chaos
in anderen Texten brennen, ohne sie zu verletzen?
Und wie hebt man fremde Asche auf,
wenn man sie hinterher als eigene erkennt?
Cruzas el bosque de las páginas,
y una palabra, alzada muchedumbre,
acerca hasta tus labios los labios de un extraño.
¿Cómo intentar con esta vaga música
que suena en lejanía, como en sueños,
traspasar otros huesos, otro caos
ardiendo en otras letras, sin herirlo?
¿Y cómo recoger esa ceniza ajena
si después, con asombro, la reconoces tuya?
Das klingt nach einer großen Demut gegenüber dem poetischen Material, das ja in der Ausgangssprache verwurzelt ist.
Glücklicherweise verschwand dieser Eindruck der Unsicherheit und des Misstrauens gegenüber Übersetzungen vollständig, als man begann, meine Gedichte zu übersetzen, und als ich Geraldine Gutiérrez-Wienken und Martina Weber kennenlernte, die mir die ausgezeichnete deutsche Übersetzung meiner in den „Wörterbüchern“ gesammelten Gedichte schenkten. Ähnlich verhielt es sich bei einigen meiner ins Italienische übersetzten Texte durch die Dichter Alessio Brandolini und Giovanna Zunica.
Bleiben wir noch bei dem Gedicht „Wörterbücher“. Die letzte Strophe lautet:
In einem kalten Regen erkannte ich
die gemeinsamen Wurzeln unserer Wörterbücher,
ich spürte, wie sie sich vermischten, und es glühte
ein Echo: die Einsamkeit zweier Stimmen
aufgehoben in ihrer Verbindung.
Bajo la lluvia fría vi mezclarse
las raíces com unes de nuestros diccionarios
Y ya solo escuché arder un eco:
Dos voces conjugando la soledad vencida.
Das Gedicht bekommt hier eine sehr persönliche Note. Es ist ja auch ein Liebesgedicht. Hast du beim Schreiben des Gedichtes auch an Mauern innerhalb der eigenen Sprache gedacht?
Jedes poetische Werk ist „persönlich“, d. h. es führt uns immer ins Imaginäre, in die ideologische Prägung und die Gefühlserziehung seines Autors. Aber ich spüre, dass ich als Dichterin nur mit der Verbindlichkeit meines Blicks antworten kann (indem ich ihn von mir selbst ablenke und versuche, die Grenzen meiner Sprache mit einem Wort zu überschreiten, das zugleich für andere offen ist) und so die Risse in der Gesellschaft aufzeigen kann, um all das zu retten, was für den Menschen wesentlich ist, und bei dem wir so kurz davor sind, es zu verlieren: die gemeinsame Freiheit und das Zusammenleben in Gerechtigkeit und Gleichheit.
Würdest du sagen, dass Poesie auch ein Medium ist, das geeignet ist, eine Botschaft in die Welt zu tragen?
Die Arbeit des Dichters ist eine einsame, aber das Gedicht ist ein Raum, der für Begegnungen offen ist, ein Ort, der geboren wird, um Ungewissheit und Schmerz bewohnbarer zu machen.
Manche sehen ja in der Musik eine Art Universalsprache, die von allen Völkern verstanden wird, weil sie direkt das Gefühl anspricht. Auch die Malerei und die Fotografie kommen ohne Übersetzung aus. Empfindest du das Zurückgeworfen-Sein auf eine Sprache auch manchmal als Behinderung der eigenen Ausdrucksmöglichkeit?
Nein, ich glaube nicht, dass die Verwendung einer einzigen Sprache Ausdrucksmöglichkeiten ausschließt, aber sie kann sie in gewisser Weise limitieren. Ich würde gerne viele andere Sprachen fließend sprechen und versuche daher, immer Gedichte in zweisprachigen Ausgaben zu lesen, auch dann, wenn ich die Sprache des Autors, den ich lese, nicht beherrsche.
Neben der semantischen Aussage leben Gedichte ja von ihrem Klang, der gerade in einer Sprache, die man nicht versteht, vorherrscht. Würdest du sagen, dass dieses Nichtverstehen des fremdsprachigen Gedichts auch hilft, das Gedicht jenseits des intellektuellen Begreifens erfahrbar zu machen?
Glücklicherweise lesen wir Dichter uns immer gegenseitig (und wir hören uns bei den Treffen gegenseitig zu, und da ist die Musikalität, die dem poetischen Akt innewohnt, sein bester Trumpf), über Grenzen, Gruppen, Generationen hinweg, denn Poesie ist eine Erfahrung, die sich sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen kreuzt und auf diese Weise persönlichen Reichtum schafft.
Abschied, Trennung, Verlust – das scheinen Themen zu sein, die sich durch deine Gedichte ziehen. Gleichzeitig erkenne ich aber immer wieder eine starke, positive Stimme, die antreibt, ermutigt.
Wage es, die beiden Seiten zu betreten,
die des Lichts und die des Dunkeln.
Atrévete a pisar en ambos lados,
en su cara de luz, también en su tiniebla.
So lautet eine Zeile aus deinem Gedicht „Aschen“. Gehe ich zu weit, wenn ich behaupte, die Gedichte spüren auch das Fremde auf, das in jedem von uns steckt und dieses Unbehagen auslöst, vor dem wir uns manchmal fürchten?
Die Fragen, die mich beim Schreiben am meisten beschäftigen, rühren von meiner Fremdheit her angesichts dieser Fata Morgana des Ichs (oder vielmehr einer Ich-Frau). Aber die Poesie gibt keine Antworten, sie macht dich nicht zum Besitzer einer Gewissheit, sondern wirft immer neue Fragen auf.
Wenn Poesie keine Antworten gibt, in welche Räume kann sie dann vorstoßen?
In gewisser Weise ist das Schreiben von Gedichten für mich eine Art, im Zweifel zu leben, in ständiger Schlaflosigkeit und schließlich aufzuwachen, ohne zu wissen, was das Schreiben ist und wozu es gut ist. Ich versuche, in ihm ein Gebiet zu finden, in dem ich mein Gleichgewicht und meine Stärken als Frau wiederfinde, und auch die aufeinanderfolgenden Ichs zu verbinden, die ich in mir sehe und die meine Erinnerung und meinen Blick ausmachen, immer im Bewusstsein, dass wir fragmentarisch sind.
Deiner Biografie habe ich entnommen, dass du neben der Lyrik auch sehr mit dem Theater verbunden bist und in verschiedenen Kompanien gespielt hast. Gibt es bei dir eine Verbindung zwischen diesen beiden Kunstformen, möglicherweise auch als Quelle der Inspiration?
Pablo del Águila, ein sehr jung verstorbener Dichter aus Granada, den ich bewundere, pflegte zu sagen:
Erst wenn man entdeckt, dass Poesie eine Lüge im theatralischsten Sinne des Wortes ist, kann man anfangen, wirklich zu schreiben.
Solo cuando uno descubre que la poesía es mentira en el sentido más teatral del término, puede empezar a escribir de verdad.
Poesie als Lüge? Wie kann man das verstehen?
Wie im Theater gibt es auch im Gedicht immer einen gewissen Kunstgriff. Selbst das, was uns am stärksten zu entblößen scheint, ist immer eine Umschreibung der Realität, bei der die persönliche Anekdote nur ein Ausgangspunkt ist.
Ja, dem kann ich folgen. Womit wir wieder bei den Leerstellen wären. Die Poesie mit ihrer Verknappung der Worte scheint besonders geeignet, diesem Entrinnen der Realität habhaft zu werden und durch sie Stimmen sprechen zu lassen, die mehr sind als wir selbst.
Das ist vielleicht der Grund, warum ich oft dazu neige, meine Texte zu konstruieren, indem ich eine bestimmte Szenerie aufbaue, um die poetische Figur durch sie hindurch wandern zu lassen und verschiedene Ebenen und Blickwinkel zu verwenden, die fast theatralische Szenen mit ihrer verwickelten Auflösung schaffen. Das Gedicht wäre also eine Art Kammertheater, in dem ich mich unter dem Deckmantel von Figuren ausdrücke, eine Stimmmaske annehme oder mich sogar im Dialog in mehrere Stimmen aufspalte.
Wie gehst du dabei vor?
Ich habe immer versucht, diese Gedichte für den Leser bewohnbar zu machen, Gedichte, die, ausgehend von einer kleinen eigenen oder fremden Anekdote, andere Sichtweisen aufzeigen, sei es auf menschliche Beziehungen oder auf Sehnsüchte, sei es auf Liebe und Entfremdung, auf unsere Städte oder unsere Zerbrechlichkeit.