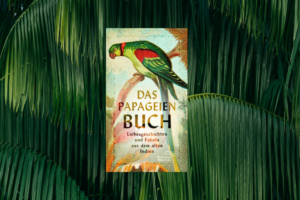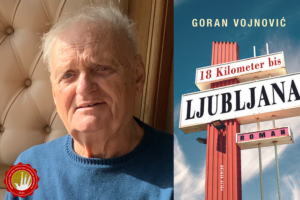Als Friedrich Oetinger und seine Frau 1949 von einer Reise nach Schweden ins heimische Hamburg zurückkehrten, hatten sie im Gepäck ein Kinderbuch, das nicht nur das Geschick des kleinen Oetinger Verlags entscheidend prägen, sondern einen anhaltenden Einfluss auf die Kinderliteratur der jungen Bundesrepublik ausüben sollte. Pippi Langstrumpf war der erste Text von Astrid Lindgren, der ins Deutsche übersetzt wurde, und die Geschichte seiner Rezeption lässt sich zugleich als Geschichte des Umgangs mit Kinderbuchübersetzungen lesen.
Übersetzungen und Überarbeitungen
Erwachsene Leser*innen, die mit Pippi Langstrumpf Kindheitserinnerungen verbinden, sind sich selten bewusst, dass die Pippi, an die sie sich so gerne erinnern, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die ist, die Kindern heute begegnet. Wie die Astrid-Lindgren-Expertin Astrid Surmatz feststellt, gehören die deutschen Fassungen der Pippi-Langstrumpf-Bücher wohl zu den am häufigsten überarbeiteten Übersetzungen der Autorin. Verlagsangaben zu solchen Eingriffen sind rar, rückblickend erscheint der Lindgren-Expertin die Erschließung der Vielzahl von Überarbeitungen, Auslassungen und Restitutionen wie ein „Puzzlespiel in postmoderner Manier“.1
Aber von Anfang an: Die Übersetzung der deutschen Erstauflage von 1949 besorgte Cäcilie Heinig, die Ehefrau des sozialdemokratischen Politikers Kurt Heinig, auf dessen Einladung hin Friedrich Oetinger nach Schweden gereist war. Das Ehepaar Heinig war 1933 aus dem nationalsozialistischen Deutschland zunächst nach Dänemark, später weiter nach Schweden geflohen. Dort begann Cäcilie mit dem literarischen Übersetzen. Ihre erste Arbeit war Lars Ahlins Tobb mit dem Manifest (Tåbb med manifestet), das 1948 bei Oetinger erschien. Heinig übersetzte alle drei Pippi-Langstrumpf-Bände sowie den ersten Band der Kalle-Blomquist-Reihe, bevor sie 1951 verstarb.
Heinig war als moderne, sozial und politisch engagierte Frau sicherlich empfänglich für den rebellischen Charakter der Hauptfigur des Romans, den sie Friedrich Oetinger bei seinem Besuch 1949 zunächst kapitelweise mündlich übersetzte. Dennoch enthält ihre Übersetzung zahlreiche Abschwächungen und Purifikationen, die nicht zuletzt wohl auch auf den Wunsch des Verlegers zurückgingen.

Nach Heinigs Tod folgten weitere Bearbeitungen, die diese Tendenz verstärkten und zum Teil zensierenden Charakter hatten. Im Klima der konservativen Nachkriegszeit wurden Passagen umgeschrieben, die aus Sicht der Verantwortlichen möglicherweise das Kindeswohl gefährden könnten. Eine der bekanntesten betrifft das letzte Kapitel des ersten Bandes, in dem Pippi nicht nur selbst mit einer Pistole schießt, sondern auch Tommy und Annika eine anbietet. Die Überarbeitung schiebt diesem gefährlichen Spiel mit Schusswaffen rigoros einen Riegel vor, indem sie Pippi selbst die Unangemessenheit dieses Spielzeugs erklären lässt:
Vill ni ha varsin pistol förresten, frågade hon. Tommy blev hänförd, och Annika ville också gärna ha en pistol, bara den inte var laddad.2
Bearbeitete Übersetzung
„Wollt ihr übrigens jeder eine Pistole haben? Aber nein, ich glaube, wir legen sie lieber wieder in die Kiste. Das ist nichts für Kinder!“3
Aktuell erhältliche, restituierte Übersetzung
„Wollt ihr übrigens jeder eine Pistole haben?“, fragte sie. Tommy war begeistert, und Annika wollte auch gern eine haben, wenn sie nur nicht geladen war.4
Die stark pädagogisierende frühere Übersetzung stellt nicht nur einen deutlichen Eingriff in den Text dar, sie steht auch im krassen Gegensatz zu Pippis weiterem Verhalten. Schließlich hat diese zuvor in derselben Szene ähnliche Bedenken zum Ausdruck gebracht, nur um sie dann effektvoll zu ignorieren:
„Låt aldrig barn handskas med skjutvapen“, sa Pippi och tog en pistol i vardera handen. „I annat fall kan det lätt hända en olycka“, sa hon och tryckte av båda pistolerna på en gång.5
„Kindern sollte man niemals Schusswaffen in die Hand geben“, sagte Pippi und nahm in jede Hand eine Pistole. „Sonst kann leicht ein Unglück geschehen.“ Und sie drückte beide Pistolen zugleich ab.6
Dass diese Szene nicht ebenfalls getilgt wurde, liegt möglicherweise daran, dass hier eben Pippi mit der Waffe hantiert, also das Ausnahmemädchen, das auch gefahrlos auf Häuserdächer klettern kann. Der Fliegenpilz freilich, den sie in einer anderen Szene so bedenken- wie folgenlos verspeist, wird nach Verlagsvorgaben in einen ungiftigen Steinpilz geändert – und bleibt dies für die nächsten Jahre.
Alle übersetzerischen Vorsichtsmaßnahmen konnten jedoch nicht ganz verhindern, dass auch die vermeintlich gezähmte Pippi bei Erscheinen Widerspruch auslöste. So nimmt etwa eine Rezension ausgerechnet an der entschärften Pilz-Szene Anstoß, da sie Kinder dazu verführen könnte, „im Walde auch erst einmal alle Pilze anzuknabbern, um festzustellen, ob sie giftig sind“7. Vor allem Pippis mangelnde Vorbildfunktion wird wiederholt kritisiert. Im Gegensatz zu diesen kritischen Stimmen stehen solche, die die innovativen und fantasievollen Elemente des Romans hervorheben.
Ein Punkt ist jedoch unstrittig: Pippis überragende Beliebtheit bei den Leser*innen. Der Roman und seine Folgebände Pippi Langstrumpf geht an Bord und Pippi in Taka-Tuka-Land werden Verkaufserfolge, Astrid Lindgren steigt rasch zu einer der beliebtesten Kinderbuchautorinnen im deutschen Sprachraum auf. In der Schweiz schreibt die Autorin Lisa Tetzner gar eine „Liebeserklärung an Pippi“8. Ob Pippis Durchbruch nun trotz oder aufgrund der übersetzerischen Eingriffe gelang, lässt sich zwar nicht mit Sicherheit sagen. Vieles spricht jedoch dafür, dass Pippis rebellischer Charakter auch in der entschärften deutschen Fassung noch genügend Aufregungspotential hatte, um als befreiend empfunden zu werden.
Wortwitz und Nonsens
In allen Bänden zeichnet sich Pippi nicht nur durch ihre körperliche, sondern auch ihre sprachliche Überlegenheit aus. Ihre Ausdrucksweise ist, ebenso wie ihr Verhalten, nonkonformistisch und zeigt, dass sie sich des subversiven Potentials von Sprache durchaus bewusst ist. Die früheren Übersetzungsversionen neigen bis in die 80er hinein dazu, weniger Sprachspiele zu übersetzen und Nonsens-Passagen entweder abzuschwächen oder ganz auszulassen. Ob es sich dabei um eine Anpassung an die deutsche Kinderliteratur mit ihrer traditionell eher schwach ausgeprägten historischen Nonsenstradition handelt oder ob hier schlicht vor manchen Herausforderungen kapituliert wurde, lässt sich kaum mit Sicherheit feststellen. Fest steht, dass die deutsche Pippi im Vergleich zur schwedischen weniger wortgewandt erscheint. So leitet etwa Pippi im ersten Band ihr unkonventionelles Pfannkuchenbacken mit einem kurzen Gedicht ein:
Nu hade de emellertid kommit ut i köket, och Pippi skrek:
— Nu ska här bakas pannekakas,
nu ska här vankas pannekankas,
nu ska här stekas pannekekas.9
In der deutschen Übersetzung wird hieraus:
Inzwischen waren sie in die Küche gekommen, und Pippi schrie:
„Jetzt woll’n wir Eierkuchen backen!“10
Im Schwedischen wird das anschließende slapstickartige Geschehen, bei dem Pippi zunächst einmal drei Eier in die Luft wirft, von denen eines prompt auf ihrem Kopf landet, bereits durch die Verdrehung des Wortes „pannkaka“ angedeutet. Die deutsche Übersetzung bleibt hingegen im normsprachlichen Bereich, und erst Pippis Eierwurf leitet den Übergang zum anarchischen Backvergnügen ein, das alle Regeln hygienischer und kindersicherer Essenszubereitung ignoriert. Erst die Neubearbeitung der 2000er11 liefert eine Übersetzung des Verses, der das volle Nonsens-Potential der Szene erschließt:
Inzwischen waren sie in die Küche gekommen und Pippi schrie:
„Jetzt woll’n wir braten Pfannekraten
Jetzt woll’n wir essen Pfannekessen
Jetzt woll’n wir futtern Pfannekuttern.“
Pippis Sprache ist zunächst nicht nur weniger wortspielreich und absurd, sondern auch deutlich höflicher. In den frühen Versionen werden Erwachsene von ihr häufiger gesiezt, und ihr Tonfall ist insgesamt respektvoller.
„Jag skulle be att få arton kilo karameller“, sa Pippi och viftade med en gullpeng.12
Die Pippi, die formvollendet um achtzehn Kilo Bonbons bitten möchte, scheint im Vergleich zu der Pippi, die schlicht und einfach Bonbons haben möchte, deutlich mehr Rücksicht auf Konventionen zu nehmen – auch wenn vielleicht der Kontrast zu der verlangten Riesenmenge an Bonbons in der früheren Version noch deutlicher ausfällt.
Die Pippi, die in Deutschland allmählich ihren kinderliterarischen Durchbruch und schließlich den Übergang zum Klassiker erlebte, war also eine durch purifizierende Überarbeitungen der ursprünglichen Übersetzung gezähmte Pippi. Aufsässig, selbstsicher, aber nicht im Übermaß, grenzüberschreitend, aber nicht ins Bedrohliche kippend, voll Sprachwitz und Nonsens, aber nicht ins Beißend-Satirische abgleitend – so lässt sich wohl die Textgestalt beschreiben, die bis Ende der 1980er verkauft und somit prägend für eine ganz Generation von Lindgren-Leser*innen wurde.
Dass diese Version nicht dem schwedischen Ausgangstext entsprach, wurde schließlich öffentlichkeitswirksam von dem Skandinavisten Hans Ritte moniert, der in einem Vortrag die provokante Frage stellte: „Ist die deutsche Pippi demnach eine Verfälschung der ‚echten‘ Pippi, eine Pippi, die nicht nur etwas anders aussieht, sondern auch ein reduziertes Innenleben hat, die moralischer ist als ihr Vorbild und auch in ihrer Respektlosigkeit nicht ganz so weit geht?“ (Ritte 1987, zit. nach Surmatz 2005, 123) Der Vortrag löste eine verlagsinterne Diskussion aus und führte zu mehreren Rücknahmen von Überarbeitungen und Kürzungen wie etwa in der Kaffeeklatschszene, in der Pippi wortreich und mit großer Drastik die (Un-)Tugenden des Hausmädchens Malin beschreibt. Das Detail, dass Malin nicht nur Gäste verbellt, sondern sich gar bei einer Gelegenheit im Bein der Pastorsfrau verbeißt, erscheint tatsächlich erst in den deutschen Ausgaben nach der Jahrtausendwende.
Während Pippi Langstrumpf und ihre Autorin in Westdeutschland mal gelobt, mal umstritten, aber mit gleichbleibend großem Erfolg in den kinderliterarischen Kanon aufstiegen, hatte es die nonkonformistische Heldin in der DDR deutlich schwerer. Der frühe Vorstoß des Strindberg-Übersetzers Klaus Möllmann für eine eigene Übersetzung wurde von dem betreffenden Verlag rundweg abgelehnt. Der Grund: Das Kinderbuch stimme „nicht mit den Prinzipien der DDR-Pädagogik überein“15. Erst im Jahr 1975 erschien eine DDR-Lizenzausgabe in vergleichsweise niedriger Auflagenhöhe. Das entsprach auch der Empfehlung, die der Autor Gerhard Holtz-Baumert in seinem Gutachten für die Druckgenehmigung ausgesprochen hatte. Trotz Vorbehalten konstatiert er dort geradezu resigniert: „Bisher fehlte die klassische Pippi bei uns; der Verlag plant eine Ausgabe. Vorbeigehen – so oder so, nicht-drucken oder nicht-reagieren – kann man wohl nicht mehr.“16 Nolens volens veröffentlichte also der Kinderbuchverlag Berlin einen Sammelband, der die ersten beiden Bände, Pippi Langstrumpf und Pippi Langstrumpf geht an Bord, enthielt und dabei auf Heinigs überarbeitete Übersetzung zurückgriff, wobei das Eingangskapitel aus dem zweiten Band getilgt wurde.17
Auch wenn das Buch offenbar in den Leihbibliotheken sehr beliebt war, erreichte Astrid Lindgren in der DDR nie die gleiche Popularität wie in der BRD. Insgesamt wurden nur vier ihrer Bücher übersetzt, und erst nach der Wiedervereinigung setzte ein Run auf die Bücher der schwedischen Autorin ein, die in Westdeutschland längst eine kinderliterarische Institution geworden war.
Prägend für die Kanonisierung Lindgrens war ihre berühmte Rede „Niemals Gewalt“, die sie 1978 anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels hielt. Diese Rede sollte Astrid Lindgrens öffentliche Wahrnehmung als Sprachrohr und Anwältin der Kinder und kinderliterarischer Klassikerautorin zementieren. Ihre glückliche Kindheit in Vimmerby auf dem Hof, der das Vorbild für die Bullerbü-Romane bildete, gehörte zu dieser öffentlichen Wahrnehmung ebenso wie ihr soziales Engagement und die Fähigkeit, sich bis ins hohe Alter eine wohlkultivierte „Kindlichkeit“ zu bewahren. Dass die reale Kindheit und Jugend der jungen Astrid Ericsson durchaus nicht nur idyllisch verlief, wurde jahrelang ausgeblendet. Auch von der Autorin selbst, die über wunde Punkte ihrer Biografie wie die Geburt des ersten Sohnes, der als uneheliches Kind von ihr getrennt aufwuchs, oder die Alkoholsucht ihres Ehemannes nicht öffentlich sprach. In der Literatur hingegen fand sie Wege, diese Problematiken aufzugreifen und zu verarbeiten.
Ein differenzierteres Bild von Astrid Lindgren entwickelte sich erst einige Jahre nach ihrem Tod. Mit der deutschen Veröffentlichung der Ur-Pippi 2007 konnten Interessierte nun die Entstehung dieses literarischen „Kind[es] des Jahrhunderts“18 nachvollziehen – und dabei feststellen, dass auch Lindgren an dem von ihr veröffentlichten Manuskript einige Zähmungen vorgenommen, politische Anspielungen reduziert, aber vor allem den Charakter der Pippi weiterentwickelt hatte. Aus einem durchgängig frechen Mädchen mit einem gnadenlosen und manchmal geradezu boshaften Humor wird in der Buchfassung eine liebevolle Freundin, die sich konsequent für die Schwächeren einsetzt. Die Veröffentlichung von Lindgrens Kriegstagebüchern19 erlaubte einen neuen Blick auf die Autorin und die Jahre, in denen Pippi entstand. Im Sinne dieser differenzierteren Vorstellung von Pippi Langstrumpf und ihrer Schöpferin sind auch die ab 2009 erschienenen Auflagen der Pippi-Bände dem schwedischen Ausgangstext deutlich näher. Gleichzeitig sind diese Neuauflagen nun wieder in das Zentrum öffentlicher Diskussionen gerückt.
N‑Wort und Südseekönig
Im Mittelpunkt steht hierbei die Bezeichnung für Pippis Vater Efraim Langstrumpf, der im Schwedischen als „negerkung“ bezeichnet wird – ein Wort, das bis dahin in allen westdeutschen Ausgaben mit dem Ausdruck „Negerkönig“ übersetzt wurde. Die Problematik dieser Übersetzung war dem Oetinger Verlag offenkundig seit Längerem bewusst. Schließlich wird bereits in der Ausgabe von Pippi Langstrumpf geht an Bord von 1986 in einer Fußnote darauf hingewiesen, dass der Ausdruck nicht mehr gebräuchlich ist. Als abwertend oder gar rassistisch wird er jedoch nicht eingeordnet, sondern stattdessen als zeittypischer Sprachgebrauch gewertet: „in diesem und folgenden Kapiteln wird der Ausdruck ‚Neger‘ verwendet. Als Astrid Lindgren Pippi Langstrumpf geschrieben hat, war das noch üblich. Heute würde man ‚Schwarze‘ sagen.“20 In der DDR-Ausgabe hingegen verwendete man von vornherein die neutrale Bezeichnung „König“, seine Untertanen werden schlicht als „Leute“ bezeichnet. Frei von Rassismen ist jedoch auch diese Ausgabe nicht, wird doch in der Beschreibung von Malins dreckiger Haut, die mit der einer Schwarzen verglichen wird, das N‑Wort verwendet.
Kritik an der Wortwahl von Pippi Langstrumpf hatte es bereits seit den 1980ern gegeben. Doch erst 2009 reagierte der Verlag mit der Änderung zum „Südseekönig“. Mittelpunkt eines größeren Medieninteresses wurde diese Bearbeitung, als vier Jahre später der Thienemann Verlag ankündigte, in Otfried Preußlers Die kleine Hexe ähnliche Änderungen vornehmen zu wollen. Dass die folgende Debatte derart erbittert ausfiel, lässt sich nur zum Teil mit dem emotionalen Wert von Kindheitserinnerungen erklären. Vielmehr erscheint es mindestens bemerkenswert, dass bei einem Werk, an dem im Laufe der Jahre derart viele, zum Teil gravierende Texteingriffe vorgenommen wurden, ausgerechnet jene Änderungen am heftigsten diskutiert werden, die die Tilgung rassistischer Begriffe betreffen.
Es gehört wohl zu den Eigentümlichkeiten der langen und wechselvollen Übersetzungsgeschichte von Pippi Langstrumpf, dass nun ausgerechnet die Fassung, die sich am engsten am schwedischen Ausgangstext orientiert, am schärfsten für eine vermeintlich mangelnde Texttreue kritisiert wird. Und es gehört zu den Widersprüchlichkeiten der Autorin Astrid Lindgren, dass die Frau, die stets für Toleranz und Respekt eingetreten war, sich zeitlebens nicht dazu durchringen konnte, mittlerweile eindeutig rassistisch belegte Wörter aus ihren Texten zu tilgen. Letztendlich ist es dem Einsehen ihrer Erben zu verdanken, die schließlich die Genehmigung zu einer Textänderung gaben – und damit möglicherweise den Klassiker davor bewahrten, vor seiner Zeit ausgemustert zu werden. Möglicherweise, denn eine – durchaus berechtigte – Kritik an den Pippi-Bänden lautet: Nur die Bezeichnungen auszutauschen ändert nichts am kolonialistischen Denken, das an einigen Stellen durchscheint. Auch als Südseekönig bleibt der weiße Efraim Langstrumpf unumstrittener „Alleinherrscher“ über jene Menschen, an deren Heimatstrand er angespült wurde. Zwar werden hier, wie so oft bei Lindgren, offenkundig auch kindliche Allmachtsphantasien bedient. Aber das Gefälle zwischen ihm und den „Eingeborenen“, die sich willig von einem weißen „König“ regieren lassen, bleibt in all seiner Problematik bestehen.
Lindgren hatte immer ein enges und streitbares Verhältnis zu ihren Texten, sie diskutierte lebhaft mit Verlagen und Übersetzer*innen, wenn ihr deren Entscheidungen nicht zusagten. Nach ihrem Tod ist es zwar nicht mehr möglich, sie selbst zu befragen, wohl aber, kritische Fragen an ihre Texte zu stellen und sie auch als Übersetzungen mit einer historischen Entwicklung zu lesen. Gerade im Fall von Pippi Langstrumpf ist die komplizierte Übersetzungsgeschichte vielleicht der Schlüssel, um die derzeit laufende Debatte um Rassismus und koloniale Strukturen in der Kinderliteratur (besser) zu verstehen. Denn sie macht eines deutlich: Die Pippi Langstrumpf, deren Text es gegen ideologische Vereinnahmungen zu verteidigen gilt, gibt es nicht. Sie ist selbst das Produkt wiederholter, ideologisch motivierter Eingriffe, Überarbeitungen und (Neu-)Übersetzungen. Umso erstaunlicher, dass ihre subversive Kraft, ihr Witz und nicht zuletzt ihre zutiefst humane Grundeinstellung sämtliche Eingriffe überdauern konnten. Das macht Hoffnung, dass Pippi Langstrumpf auch in diesem Jahrhundert heimisch werden kann.
Ein kluger Vogel erzählt
Im Portrait: Hinrich Schmidt-Henkel
„Eine explizite Strategie habe ich beim Übersetzen eigentlich selten“
6 Bücher aus Rumänien und Moldau
Klaus Detlef Olof: der Polyphoniker
Lisa Palmes: die Vielschichtige
- Astrid Surmatz: Pippi Långstrump als Paradigma. Die deutsche Rezeption Astrid Lindgrens und ihr internationaler Kontext. Tübingen, Basel: A. Francke 2005, S. 162. Surmatz‘ Monographie bietet die wohl detailreichste Untersuchung zur Übersetzungsgeschichte von Pippi Langstrumpf bis 1999.
- Astrid Lindgren: Pippi Långstrump. Rabén & Sjögren 1945, S. 172.
- Astrid Lindgren: Pippi Langstrumpf. Übersetzt von Cäcilie Heinig. Hamburg: Oetinger 1957, S. 205.
- Astrid Lindgren: Pippi Langstrumpf. Übersetzt von Cäcilie Heinig. Hamburg: Oetinger 2007, S. 138/139. Diese Fassung entspricht der ursprünglichen Übersetzung der Erstausgabe (Lindgren: Pippi Langstrumpf. Hamburg: Oetinger 1949, S. 205).
- Lindgren 1945, 127.
- Lindgren 2007, S. 138.
- Ursel Wulf: „Astrid Lindgren: Pippi Langstrumpf“. Rezension in Bücherei und Bildung (1950), S. 804–805.
- Lisa Tetzner: „Liebeserklärung an Pippi“. In: Jugendschriften-Warte (1953) 11, S. 8–9.
- Lindgren 1945, 17.
- Astrid Lindgren: Pippi Langstrumpf. Hamburg: Oetinger 1949, S. 18.
- Laut Surmatz lehnte der Oetinger Verlag im Überarbeitungsmanuskript von 1988 die Übertragung des Nonsens-Verses wegen „Unübersetzbarkeit“ ab. (Surmatz 2005, 135/135)
- Astrid Lindgren: Pippi Långstrump går ombord. Stockholm: Rabén & Sjögren 2001 (1946), S. 22.
- Astrid Lindgren: Pippi Langstrumpf geht an Bord. Übersetzt von Cäcilie Heinig. Hamburg: Oetinger 1958, S. 30.
- Astrid Lindgren: Pippi Langstrumpf geht an Bord. Übersetzt von Cäcilie Heinig. Hamburg: Oetinger 2007, S. 26.
- Vgl. Surmatz 2005, 127/128.
- Zitiert nach Caroline Roeder: „Archivalisches zur Astrid Lindgren-Rezeption in der DDR“. In: Astrid Lindgren – Werk und Wirkung. Internationale und interkulturelle Aspekte. Hrsg. von Svenja Blume, Bettina Kümmerling-Meibauer, Angelika Nix. Peter Lang 2009, S. 105–122, hier S. 113.
- Ironischerweise erschien Pippi in der DDR zu einem Zeitpunkt, als sie im Westen gerade aus Sicht einer marxistischen Literaturwissenschaft in die Kritik geraten war. War zuvor Pippis Infragestellung der Normen und Institutionen der Erwachsenenwelt als gefährlich erschienen, schien genau diese plötzlich nicht weit genug zu gehen. Pippis karnevaleskes Unterlaufen gesellschaftlicher Rituale erschien aus dieser Perspektive als Ventil für die bürgerliche Unordnung, die gerade dadurch letztlich aufrecht erhalten würde.
- Vgl. Lundqvist, Ulla: Århundradets barn. Fenomenet Pippi Långstrump och dess förutsättningar. Malmö 1979 sowie Angelika Nix: Das Kind des Jahrhunderts im Jahrhundert des Kindes. Zur Entstehung der phantastischen Erzählung in der schwedischen Kinderliteratur. Rombach 2002.
- Astrid Lindgren: Die Menschheit hat den Verstand verloren. Tagebücher 1939 – 1945. Aus dem Schwedischen von Angelika Kutsch und Gabriele Haefs. Ullstein 2015.
- Astrid Lindgren: Pippi Langstrumpf geht an Bord. Übersetzt von Cäcilie Heinig. Hamburg: Oetinger 1987, S. 10.