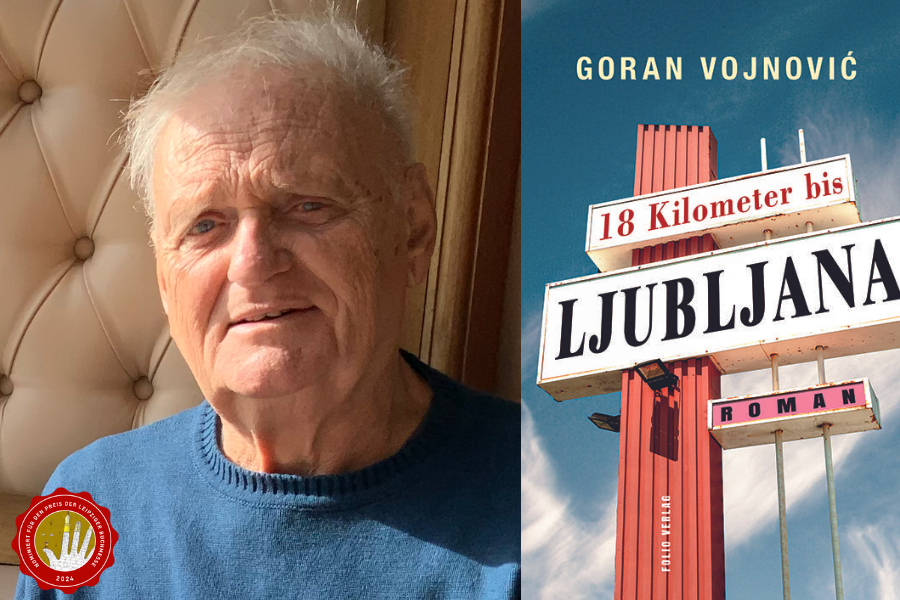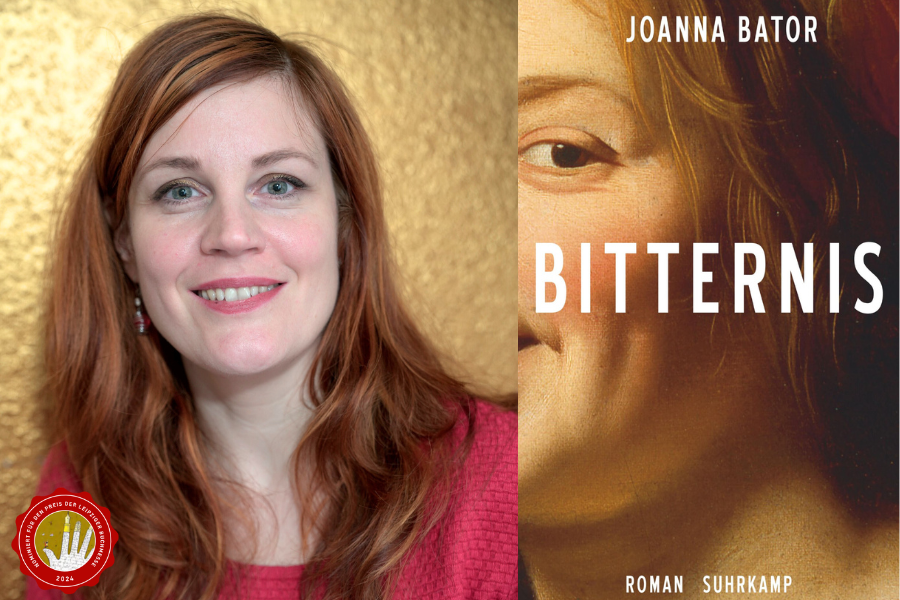Trotz intensiver Berichterstattung in allen Medien: Über das Land, das in wenigen Tagen die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer ausrichtet, ist in Deutschland noch immer seltsam wenig bekannt. Auch 12 Jahre nachdem Katar unter skandalösen Umständen eines der größten Sportevents der Welt zugesprochen wurde, dominieren Klischees und Vorurteile hierzulande das Bild von der dortigen Gesellschaft, die sich in diesem Zeitraum so rasant verändert hat wie wohl nur wenige auf dem Planeten.
Die Tausenden ausländischen Arbeiter, die die Organisatoren mit ihrer verantwortungslosen Arbeitsorganisation auf dem Gewissen haben, wird nichts und niemand mehr ins Leben zurückbringen. Doch all jene, die dieses Martyrium gerade nicht unter den Tisch kehren wollen, sollten eigentlich ein Interesse an einem tiefgreifenderen gegenseitigen Verständnis haben. Gerade das scheint aber kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft von der Katar-/FIFA-PR („beste WM aller Zeiten“) einerseits und der Boykottbewegung („WM der Schande“) andererseits in den Hintergrund gedrängt zu werden.
Einen gewissen Anteil an dieser Marginalisierung hat auch der deutsche Buchmarkt. Denn während es aus arabischsprachigen Ländern wie Ägypten und Syrien durchaus eine rege Übersetzungstätigkeit gibt, erscheinen aus Regionen wie dem Maghreb oder eben den Golfstaaten so gut wie keine Bücher in deutscher Sprache. Ein Umstand, über den sich die renommierte Arabisch-Übersetzerin Larissa Bender zuletzt im Interview mit der Online-Plattform Arablit einigermaßen konsterniert äußerte:
Aus diesen Ländern interessieren fast ausschließlich Bücher über verfolgte oder verhaftete Journalist*innen oder über unterdrückte oder der Unterdrückung entkommene Frauen. Und diese Bücher werden dann mit einem entsprechenden Cover versehen, auf dem verschleierte Frauen zu sehen sind. Oder Frauen, die wider Erwarten ihre Reize zeigen. Aber welche Literatur in diesen Ländern geschrieben wird, ist hier völlig unbekannt. Da sehe ich leider auch kaum eine Entwicklung.
Warum ist das so? Und warum hat sich in den letzten 12 Jahren fast nichts daran verändert?

Der katarischen Arabistin und Autorin Noura Faraj begegnen im Ausland immer wieder die gleichen Vorurteile, schreibt sie im E‑Mail-Interview. Innerhalb der arabischen Welt, so die Schriftstellerin, die als Assistenzprofessorin an der katarischen Dependance der Carnegie Mellon University lehrt, werde ihr Schreiben nicht ernst genommen. Im Gegensatz zu Saudi-Arabien oder Kuwait sehe man Katar schlicht nicht als Produzent bedeutender arabischer Literatur an.
Und außerhalb der arabischen Halbinsel sei es nur noch schlimmer:
Es gibt leider viele Stereotypen, Übertreibungen und Missverständnisse, so viel steht fest. Besonders, was die Rolle der Frau betrifft. Da existieren völlig unrealistische Bilder, die immer noch auf den Ansichten des Orientalismus beruhen. Ich bin Professorin an einer Universität, habe im Ausland promoviert. Viele der Frauen und Mädchen in meiner Familie haben einen höheren Universitätsabschluss, viele sind auch wirtschaftlich selbständig, alle Frauen gehen arbeiten. Wenn eine Frau nicht arbeitet, dann kommt uns das sehr merkwürdig vor.
Faraj selbst hat in Jordanien studiert; ihre literarischen Veröffentlichungen sind im Libanon und in Saudi-Arabien erschienen. Die Titelgeschichte ihres Erzählbandes „Üble Beschimpfungen“ (al-Marāǧim) ist ins Englische und 2021 von dem renommierten Übersetzer Hartmut Fähndrich auch ins Deutsche übersetzt worden. Als Feministin sieht sich Faraj dennoch nicht. In „Üble Beschimpfungen“ (wie auch in anderen Ich-Erzählungen wie ihrem Roman „Rose Water“, der leider bisher nur auszugsweise ins Englische übersetzt ist) lässt sie das Geschlecht der erzählenden Figur bewusst offen.
Vergrößern

Doch auch wenn man ihrer Erzählung „Üble Beschimpfungen“ einen politischen Subtext nicht absprechen kann, weicht Faraj allen Fragen, die die anstehende Fußball-WM oder politische Themen berühren, aus. Auch ihr Schreiben will sie als private Aktivität, als Ausdruck persönlicher Gefühle und Gedanken verstanden wissen
Diese Vorsicht ist verständlich. Forschere politische Aussagen können für katarische Intellektuelle nämlich durchaus ernste Konsequenzen haben, wie die jüngere Vergangenheit des Landes unter Beweis gestellt hat.
Es war am 16. November 2011, heute vor elf Jahren, als Mohammed al-Ajami, ein Student der arabischen Literatur an der Universität in Kairo, bei der Einreise am Flughafen Doha festgenommen wurde. Es dauerte drei Monate, die er in einer winzigen Isolationszelle verbringen musste, bis ihm überhaupt Kontakt mit Freunden und Angehörigen gestattet wurde.
Al-Ajami war zu diesem Zeitpunkt weder vorbestraft noch bewaffnet, er hatte niemanden umgebracht und hegte keinerlei terroristische Pläne. Was aus Sicht der Machthaber in Katar eine solche Behandlung rechtfertigte, waren seine Gedichte.
Schon Monate vor dem Beginn der damaligen Aufstände in Tunesien und anderen arabischen Staaten, im Sommer 2010, hatte al-Ajami in Kairo im privaten Rahmen ein politisches Gedicht vorgelesen – unter dem Titel „Kairo-Gedicht“ verbreitete es sich in den sozialen Netzwerken der gesamten arabischen Welt. Sein 2011 entstandenes „Jasmingedicht“, das später auch in der Übersetzung von Mahmoud Hassanein und Hans Thill auf Deutsch erscheinen sollte, erlangte eine ähnliche Popularität, wahrscheinlich wegen Zeilen wie dieser:
Warum soll das Volk nicht einfach den als Herrscher wählen, den es schätzt.Und vergisst die Autokraten mit ihrem Geschwätz.Sagen wir doch den Leuten, die nur nach ihrem Nutzen schauen,morgen wird ein anderer herrschen und seine Paläste bauen.
Als al-Ajami nach vier Monaten endlich (wenn auch ohne ordentlichen Rechtsbeistand) ein Gerichtsverfahren vor einem geheim tagenden Strafgericht in Doha bekam, warf man ihm wegen dieser und anderer Zeilen „öffentliche Anstiftung zum Sturz der Regierung“ und „Beleidigung des Emirs“ vor.
Dass al-Ajami im Zusammenhang mit dem Prozess zu Protokoll gab, Katar sei ein „gutes Land“ und der Emir Scheich Hamad ein „guter Mann, kein Saddam oder Gaddafi“, half ihm wenig. Auf Grundlage seiner angeblichen Straftaten wurde Mohammed al-Ajami zu lebenslanger Haft verurteilt. Wenn die katarische Fußball-Nationalmannschaft am 29. November zu ihrem letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande aufläuft, ist das zugleich der zehnte Jahrestag dieses skandalösen, menschenrechts- und rechtsstaatswidrigen Urteils.
Drei Jahre später, im Jahr 2015, saß Mohammed al-Ajami noch immer in seiner Gefängniszelle fest und die FIFA hatte soeben dem internationalen Druck nachgegeben und die katarische Fußball-WM in die Wintermonate verlegt – ein erstes Zeichen, dass die internationale Kritik an der Vergabe das Land und die Planung der WM noch auf Jahre beeinflussen und prägen würde.
In dieser Phase verstärkte Katar noch einmal seine Bemühungen, durch gezielte Investments internationale Reputation aufzubauen. Neben dem Sport – das umstrittene Engagement der staatlichen Fluglinie Qatar Airways beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München ist das hierzulande wohl bekannteste Beispiel – wurde auch die Kultur als geeignete Bühne ausgemacht, auf der sich Katar als weltoffener Wohlfahrtsstaat inszenieren konnte.
Auf diese Weise entdeckten die Machthaber in Katar ihr Interesse für Literatur und hoben mit einigem Pomp zwei neue Literaturpreise aus der Taufe. Neben einem auf die arabischsprachige Welt ausgerichteten Literaturpreis, dem Katara Prize for Arabic Novel, lobte man auch einen deutlich höher dotierten internationalen Übersetzungspreis aus: den Sheikh Hamad Award for Translation and International Understanding. Mit einem Gesamtpreisgeld von zunächst 1 Mio. Dollar (das inzwischen sogar verdoppelt wurde, wohl um den konkurrierenden Sheikh Zayed Book Award in Abu Dhabi zu übertrumpfen) war der Sheikh Hamad Award aus dem Stand der höchstdotierte reine Übersetzerpreis der Welt.
Der Sheikh Hamad Award sollte zu gleichen Teilen an Übersetzerinnen und Übersetzer aus dem Arabischen und ins Arabische vergeben werden. Neben dem Englischen, das seit 2015 immer Partnersprache war, wird Jahr für Jahr eine (oder mehrere) Schwerpunktsprache ausgewählt, darunter auch kleine bis winzige, wie Urdu, Bosnisch oder Usbekisch.
Umrankt wurde die Inauguration des Preises von einem Programm voller blumiger Versprechungen:
Der Preis ehrt Übersetzerinnen und Übersetzer, die zur Freundschaft und Verständigung zwischen den Völkern der Erde beitragen. Er soll exzellente Verdienste auszeichnen, zur Kreativität inspirieren, die höchsten ethischen und moralischen Standards anlegen und einen Beitrag zur Verbreitung von Diversität, Pluralismus und Offenheit leisten.
The Award seeks to honour translators and acknowledge their role in strengthening the bonds of friendship and cooperation amongst peoples and nations of the world. It hopes to reward merit and excellence, encourage creativity, uphold the highest moral and ethical standards, and spread the values of diversity, pluralism and openness.
Diese Worte mussten aus dem offiziellen Munde einer Regierung, die seit drei Jahren einen Dichter unter fadenscheinigen Begründungen in Haft hielt, einfach nur verlogen klingen. Und so konnte es kaum überraschen, dass es gleich bei der ersten Preisverleihung zu einem Eklat kam: Der britische Arabist und Übersetzer Humphrey Davies verließ die Konferenz, in deren Rahmen der Preis erstmals vergeben werden sollte, aus Protest gegen die fortdauernde Inhaftierung von Mohammed al-Ajami.
Im Februar des Folgejahres sorgte Davies zusammen mit zahlreichen anderen namhaften Persönlichkeiten der Arabistik-Szene mit einem Boykottaufruf für Aufsehen. Unter anderem hieß es dort:
Solange die Machthaber in Katar Künstler ins Gefängnis stecken, wird man sie nicht als Kunstmäzene respektieren. Das müssen sie verstehen. Sie können Mäzen oder Kerkermeister sein – aber nicht beides zugleich.
Qatar’s rulers need to understand that they will not be respected as patrons so long as they imprison artists for practicing their craft. Qatar’s rulers now face a clear choice: either patron or jailor, but not both.
Auf den Tag genau einen Monat später wurde Mohammed al-Ajami begnadigt und freigelassen.
Auch wenn dafür das Emirat nie offizielle Gründe dafür angab, von einer Entschuldigung ganz zu schweigen, brachten Menschenrechtsaktivisten al-Ajamis Freilassung sofort mit der wachsenden internationalen Öffentlichkeit im Vorfeld der Fußball-WM in Verbindung. Es ist jedoch durchaus auch plausibel, dass mit der Begnadigung der millionenschwere „Sheikh Hamad Award“, immerhin eines der Flaggschiffe der internationalen katarischen Kulturpolitik, gerettet werden sollte.
Zwei Jahre nach dem Boykottaufruf und der anschließenden Freilassung al-Ajamis wurde Deutsch als Schwerpunktsprache des Sheikh Hamad Awards bestimmt. Die Wahl der Jury fiel neben sechs Übersetzungen aus dem Deutschen ins Arabische (darunter philosophische Werke von Nietzsche und Cassirer, aber auch die arabische Fassung von David Wagners Roman Leben) auf zwei Übersetzungen klassischer arabischer Literatur ins Deutsche: Stefan Weidners Gesamtübersetzung des Gedichtzyklus Turǧumān al-Ašwāq (unter dem passenden deutschen Titel „Der Übersetzer der Sehnsüchte“) und Berenike Metzlers Übersetzung des Kitāb Fahm al-Qurʾān von Ḥāriṯ b. Asad al-Muḥāsibī unter dem Titel „Den Koran verstehen“. Der bereits oben als Übersetzer von Noura Faraj erwähnte Hartmut Fähndrich erhielt einen Sonderpreis für sein übersetzerisches Lebenswerk.
Vergrößern

Die Preisverleihung im Dohaer Ritz-Carlton-Hotel, die auch auf Youtube im Video festgehalten ist, beschreiben sowohl Fähndrich als auch Weidner als unpersönliche, bizarre Veranstaltung – anstelle der privat verhinderten Berenike Metzler wurde einer Platzhalterin namens Leslie Tramontini ihr Preis überreicht, obwohl Frau Metzler Tramontini nach eigener Auskunft gar nicht bekannt ist.
Die Würdigung, so beschreibt es Fähndrich am Telefon, sei trotz des enorm hohen, in bar ausgezahlten Preisgeldes von 100.000 US-Dollar pro Kopf ohnehin nur ein Nebenschauplatz der Veranstaltung gewesen. Auch und vor allem gehe es darum, so Fähndrich, „den Emir ins Rampenlicht zu rücken“. Er als Person sei aber von einer Jury ausgewählt und für preiswürdig befunden worden – der Preis sei eben keine Belohnung für willfähriges Übersetzen oder gar Verhalten.
Das Argument, sein Verhalten stütze das Regiment eines fragwürdigen Herrschers, lasse er gelten. Aber für ihn habe das „keine Rolle“ gespielt. „Ich kann mich nicht auf den Standpunkt zurückziehen, bestimmten Leuten nicht mehr die Hand zu schütteln“, so Fähndrich, „denn dann wäre ich out und könnte meinen Beruf nicht mehr ausüben.“ Sein Lebenswerk sei es, arabischen Stimmen – insbesondere auch unbequemen – Gehör im deutschen Sprachraum zu verschaffen, diesen Stimmen gelte seine professionelle Loyalität.
Auch Stefan Weidner teilt per E‑Mail mit, er halte die Vorstellung, einen solchen Preis zu boykottieren, für eine „Quixoterie“. Er selbst als „unbekannter Übersetzer“ sei angesichts des Milliarden-Business der Sport- und Medienwelt dafür nicht der richtige:
Wer das macht, dem würde ich moralischen Größenwahn vorwerfen, außerdem ein wahnwitziges, von Eitelkeit getriebenes Sendungsbewußtsein: Der Übersetzer als Luther, der letzte Aufrechte inmitten der sonstigen gesamtwestlichen Werteheuchelei. Und es hätte sich ja bei uns noch nicht einmal jemand dafür interessiert. Allenfalls die Konkurrenz der Qataris in Saudi und UAE hätte sich gefreut.
Mit ihrem Dilemma stehen die Preisträger aus Doha beispielhaft für jeden einzelnen Fußballspieler, ‑funktionär oder ‑fan, den dieses beispiellos verkorkste Turnier vor die Wahl zwischen Boykott und schlechtes Gewissen zu stellen scheint.
Doch es gibt immer dritte Wege, und vielleicht bildet die Literatur einen guten Einstiegspunkt für alle, die sich für die Umstände in Katar jenseits der großen Politik interessieren und weder der rigorosen Boykottbewegung noch dem Völkerverständigungs-Kitsch der FIFA etwas abgewinnen können.
Die beiden 2018 in Doha prämierten Bücher von Stefan Weidner und Berenike Metzler sind nach wie vor im Buchhandel erhältlich und wer sie liest, hat zwar vordergründig nichts über Katar, aber dafür gleich so viel über die islamische Kultur gelernt, dass er mit anderen Augen auf die Region schauen wird. Hartmut Fähndrichs bereits erwähnte Anthologie „Kleine Festungen“ enthält nicht nur Noura Farajs Kurzgeschichte in deutscher Übersetzung, sondern bietet auch darüber hinaus einen beeindruckenden Rundumblick über die gesamte arabischsprachige Welt von Marokko bis zum Irak. Und katarische Literatur in deutscher oder englischer Übersetzung ist zwar nicht leicht zu finden, aber durchaus erhältlich – unter diesem Beitrag findet sich eine Literaturliste.
Die diesjährige Fußball-WM in Katar ist und bleibt ein Tiefpunkt des Weltfußballs, ein bizarres, blutbeflecktes Spektakel, ein ewiges Symbol für die Korruption und Rückgratlosigkeit einer abgehobenen Elite. Aber da sie nun einmal stattfindet, sollte von der gigantischen weltweiten Aufmerksamkeit, die diesem winzigen Fleck Erde plötzlich zuteil wird, ein klein wenig auch für die Literatur dieser Region abfallen, die viel reicher ist als wir es hierzulande wahrnehmen.
Zum Weiterlesen
Al-Ajami, Mohammed: Jasmingedicht. In: allmende – Zeitschrift für Literatur 95/2015. S. 56–60. Aus dem Arabischen von Mahmoud Hassanein und Hans Thill. http://www.mitteldeutscherverlag.de/zeitschriften/allmende/allmende-zeitschrift‑f%C3%BCr-literatur-95–2015-detail
Al-Mahmoud, Abdulaziz: The Corsair. Hamad bin Khalifa University Press 2013. https://hbkupress.com/en/book/corsair
Fähndrich, Hartmut (Hrsg.): Kleine Festungen. Geschichten über arabische Kinder und Jugendliche. Edition Faust 2021. (Enthält die Kurzgeschichte „Üble Beschimpfungen“ von Noura Faraj.) https://editionfaust.de/produkt/kleine-festungen/
Faraj, Noura: Rosewater (Auszug). Aus dem Arabischen ins Englische übersetzt von Jonathan Wright. In: Banipal – Magazine of Modern Arab Literature 69. https://www.banipal.co.uk/back_issues/113/issue-69/
Fromm, Nicolas: Katar. Geld, Sand und Spiele. C.H.Beck 2022. https://www.chbeck.de/fromm-katar/product/33743712
Ibn Arabi: Der Übersetzer der Sehnsüchte. Aus dem Arabischen von Stefan Weidner. Jung und Jung 2016. https://jungundjung.at/der-uebersetzer-der-sehnsuechte/
Metzler, Berenike: Den Koran verstehen. Das Kitāb Fahm al-Qurʾān des Ḥāriṯ b. Asad al-Muḥāsibī. Diskurse der Arabistik 22. Harassowitz Verlag 2016. https://www.harrassowitz-verlag.de/Den_Koran_verstehen/titel_1544.ahtml