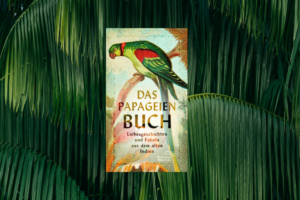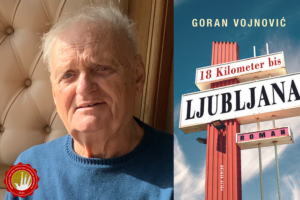Der Kanon-Verlag konnte sich kein bedeutsameres Datum als den 24. Februar 2023 aussuchen, um die deutsche Übersetzung von Lisa Weedas Debütroman Aleksandra zu veröffentlichen. An diesem Tag jährte sich der russische Überfall auf die Ukraine zum ersten Mal. Das Land ist Schauplatz von Aleksandra, genauer gesagt spielt der Roman in der selbsternannten Volksrepublik Luhansk im Osten der Ukraine.
Aleksandra ist aber keine politische Anklageschrift. Die niederländisch-ukrainische Autorin Lisa Weeda zeichnet darin ihre eigene Familiengeschichte nach. Ihren Erstling hat Weeda im Dezember 2021, also wenige Wochen vor dem russischen Angriffskrieg in den Niederlanden veröffentlicht. Dort avancierte Aleksandra schnell zum Bestseller und wurde für den renommierten Libris-Buchpreis nominiert. Die autofiktionale Erzählung hat Birgit Erdmann nun ins Deutsche übersetzt.
Die Ukraine im Kaleidoskop
Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Großmutter von Lisa Weeda, die titelgebende Aleksandra. Auf ihren Wunsch hin reist die Ich-Erzählerin Lisa nach Luhansk, um dort ein Sticktuch auf das Grab eines Verwandten zu legen. Dieses Tuch hat Aleksandra wiederum von ihrer eigenen Großmutter geschenkt bekommen. Darin ist die Geschichte der Familie gestickt: Rote Fäden stehen für das Glück, schwarze für die Trauer.
Doch Lisas Reise endet abrupt an einem Schlagbaum. Grenzbeamte verweigern ihr den Eintritt in die Volksrepublik Luhansk. Als eine Mine explodiert, nutzt Lisa jedoch den Moment des Chaos, um die Grenze dennoch zu überqueren. Sie rennt über ein Kornfeld und entdeckt den magischen Palast des verlorenen Donkosaken. Er ist der erzählerische Dreh- und Angelpunkt in Aleksandra, an dem alle Handlungsstränge zusammenlaufen.

Die darauffolgende Erzählung erstreckt sich über mehr als ein Jahrhundert. Aleksandra ist nicht nur ein Familienepos, sondern auch ein Porträt der Donbasregion. Um diese Geschichte zu erzählen, nutzt Lisa Weeda einen literarischen Trick: So stolpert ihre Ich-Erzählerin im Palast des verlorenen Donkosaken einmal quer durch die Zeit. In jeder Kammer dieses erzählerischen Labyrinths spielen sich verschiedene Szenen der ukrainischen Geschichte ab, die Lisas Familie miterlebt: die Zwangskollektivierung unter Stalin, die Hungersnot Holodomor, der Überfall der Nazis und die russische Aggression im Donbas seit 2014.
Wärme und magischer Realismus
Dieser magische Realismus, mit dem Weeda das Geschehen schildert, bereitet allerdings vor allem eines: viel Mühe. Die Lektüre von Aleksandra erfordert eine Menge Konzentration, denn die Geschichte zeichnet sich durch etliche Zeitsprünge und Perspektivwechsel aus. Da kann es schwerfallen, den Überblick über die Handlung zu behalten. Immer wieder in den Stammbaum zu schauen, der im Buch abgedruckt ist und die Familienmitglieder von Lisa sortiert, kann hilfreich sein – unterbricht aber den Lesefluss.
Wohltuend ist dagegen, mit wie viel Wärme Lisa Weeda ihre Familiengeschichte aufschreibt. Jede Episode, die die Ich-Erzählerin im Palast des verlorenen Donkosaken erlebt, gleicht einem Miniaturporträt der Ukraine, die Weeda nüchtern und empathisch wiedergibt. Diese Darstellungen sprechen für sich, Weeda verzichtet konsequent auf Moralisierungen, politische Statements oder Agitation.
Auf manche dürften allerdings die Fantasy-Roman-Elemente befremdlich wirken, die Weeda immer wieder in die Erzählung streut. An einer Stelle im Roman unterhält sich die Ich-Erzählerin mit einer Lenin-Statue, die kurzerhand zum Leben erweckt wird. An anderer Stelle verwandelt sich Urgroßvater Nikolaj in einen weißen Hirsch, in dessen Rücken ein goldschimmernder Pfeil steckt. Hier dürfte mit der Autorin ein Tacken zu viel Fantasie durchgegangen sein.
Man merkt ihrem Erstling an, dass Lisa Weeda neben der Literatur als Drehbuchautorin von Virtual-Reality-Filmen arbeitet. Insgesamt ist Aleksandra ein stilistisch überfrachteter Roman. Wer ihn liest, muss sich auf den magischen Realismus als dominierendes Erzählprinzip einlassen können. Das gilt genauso für die Übersetzung.
Russische Städtenamen
Birgit Erdmann gelingt es ausgezeichnet, Lisa Weedas Familienepos ins Deutsche zu transportieren. Die Prosa der Übersetzung ist klar und einfühlsam. Das Feuilleton hebt etwa die „mit Leichtigkeit vorgetragene Präzision“ (taz) und die „erstaunlich leichtfüßig und mit sehr viel Wärme“ (Deutschlandfunk) dargebotene Erzählung hervor, ohne auch nur Erdmanns Anteil daran zu erwähnen.
Getrübt wird diese übersetzerische Leistung durch einen eindeutigen Fehler, der allerdings mutmaßlich auf das Konto des Kanon-Verlags geht: Alle ukrainischsprachigen Eigennamen werden in russischer Schreibweise übernommen.
So ist in Aleksandra etwa nicht die Rede vom „Donbas“ (ukrainisch), sondern vom „Donbass“ (russisch). Die Volksrepublik „Luhansk“ (ukrainisch) heißt im Roman „Lugansk“ (russisch). Und die Stadt „Odesa“ (ukrainisch) bekommt ein zweites „s“, so wie es in der russischen Transliteration üblich ist.
Diese Art, mit ukrainischen Eigenbezeichnungen im Deutschen umzugehen, überrascht beim Lesen. Aleksandra ist kein patriotischer Roman und dennoch eine Erzählung, die Partei für die Ukraine ergreift. Die ukrainische Transliteration wäre also nur folgerichtig gewesen.
Der Kanon-Verlag scheint sich darüber im Klaren zu sein, dass die Übersetzung in einem politisch-kulturell sensiblen Umfeld erscheint. Im Vorwort merkt der Verlag wortwörtlich an: „Seit dem 24.02.2022 wird verstärkt die ukrainische Transliteration von Städtenamen verwendet.“ Durch das Passiv verschleiert der Kanon-Verlag, wer die ukrainischen Städtenamen verwendet. Kein Wunder, er selbst tut es nicht.
Mit einer Ausnahme: Auf der letzten Buchseite ist eine Karte der Ukraine abgebildet, in der die von Russland angefochtenen Gebiete im Donbas schraffiert hervorgehoben werden. Dort heißen die Städte plötzlich „Odesa“, „Kyjiw“ und „Luhansk“.
Bei der Transliteration hätte dem Roman eine konsequent-ukrainische Übersetzungslösung gutgetan. Sicherlich sind auch ein Jahr nach Beginn des Angriffskriegs die russischen Schreibweisen noch immer präsenter als die ukrainischen. Trotzdem wären der Verlag und die Übersetzerin mit einer durchgängig ukrainischen Transliteration in Zeiten der überwältigen Ukraine-Solidarität wahrscheinlich nicht einmal das Risiko eingegangen, sprachpuristische Leser:innen zu verschrecken.
Literarische Monologe
Die Erzählung von Aleksandra ist außerdem von zahlreichen Monologen geprägt. Die Ich-Erzählerin Lisa tritt weniger als handelnde Figur auf, sondern eher als Nebendarstellerin, die ihre eigene Familiengeschichte beobachtet und den Erzählungen ihrer Verwandten lauscht. Diese ausschweifenden Monologe ziehen sich zum Teil über eine ganze oder mehrere Seiten.
Wörtliche Rede ist ein klassisches Übersetzungsproblem. Die Übersetzer:innen müssen abwägen, wie viel Raum sie der freien mündlichen Sprache zu Lasten der stärker regulierten Schriftsprache einräumen, um dem Gesagten die nötige Authentizität zu verleihen. Beispielsweise ist es eher ungewöhnlich, die Vergangenheitsform in der wörtlichen Rede auf Deutsch im Präteritum wiederzugeben.
Birgit Erdmann entscheidet sich dafür, die Übersetzung der wörtlichen Rede am Schriftdeutsch zu orientieren. In einem mehrseitigen Monolog heißt es zum Beispiel:
‘Het tempo van het leven in Loegansk was anders, het was mechanischer, sneller,’ zegt Nikolaj. ‘Het werd Anna en mij steeds duidelijker waar het land naartoe moest bewegen. De stad hing vol plakkaten met tractoren en fabrieken. Door luidsprekers op het centrale plein en in de fabriek klonken de stemmen van de leiders, ze vertelden ons hoe goed het met het ons land ging. In Moskou verrezen tientallen nieuwe gebouwen tegelijk, lazen we in de Pravda, die door de hele stad op aankondigingsborden hing. […]’
„Das Tempo des Lebens war in Lugansk anders, mechanischer, schneller“, sagt Nikolaj. „Anna und mir wurde immer deutlicher, wohin sich das Land bewegen würde. Immer mehr Plakate mit Traktoren und Fabriken hingen in der Stadt. Aus den Lautsprechern auf dem zentralen Platz und in den Fabriken dröhnten die Stimmen der Führer, die uns erzählten, wie gut es unserem Land ging. In Moskau schossen dutzende neue Gebäude gleichzeitig empor, lasen wir in der Prawda, die in der ganzen Stadt auf Mitteilungstafeln aushing. (…)“
Keine Frage: So spricht niemand. Und obwohl dieser Monolog eher hölzern daherkommt, fügt er sich sehr gut in den Familienepos ein. Textnah übersetzte Passagen wie diese verdeutlichen, dass die Erzählung auf wahrscheinlich Jahrhunderte alten mündlichen Überlieferungen aufbaut.
Lisa Weeda hat darüber hinaus eine ausgesprochene Vorliebe dafür, bei den Verben des Sagens besonders viel Kreativität an den Tag zu legen. Das Sagen zu charakterisieren, sei es durch Adverbien oder weitere Handlungen, gilt für viele allerdings als schlechter Stil. Erdmann übersetzt auch diese vermeintlichen Anfängerfehler aus dem Original:
- „Verflixt“, sagte sie und schob mir den Brotkasten über den Esstisch zu.
- „Unvorstellbar“, sagte sie erbost, „habe ich es dir nicht gesagt, sie tun genau dasselbe, als ich noch ein kleines Mädchen war.“
- „Das ruhige Rot unserer Familienlinien ist in Gefahr“, flüsterte Aleksandra, nachdem sie mit Andriy telefoniert hatte.
- „Wer den Weizen hat, hat die Macht“, sagte eines Tages ein alter Mann zu Anna auf dem Markt in Lugansk.
- „Routine“, murmelt der Mann und tastet Kolja weiter ab, von den Hüften abwärts und wieder nach oben zu den Achseln.
- „Sehen wir aus wie korrupte Touristen?“, bellt er.
Ein paar Szenen in Aleksandra wirken dadurch etwas manieristisch – teilweise leider auch albern. Hier und da hätte die Übersetzerin sicherlich eingreifen können, um der Autorin den einen oder anderen Schnitzer zu ersparen (zum Beispiel: „Das ruhige Rot unserer Familienlinien ist in Gefahr“, flüsterte Aleksandra. Sie hatte gerade mit Andriy telefoniert).
Alles in allem ist Aleksandra aber eine beeindruckende Geschichte. Die Lektüre ist stellenweise fordernd, doch es lohnt, sich durch die 288 Seiten zu kämpfen. Mit dem Roman hat Lisa Weeda ein einfühlsames Porträt der Ukraine geschaffen, das Birgit Erdmann hervorragend übersetzt hat.