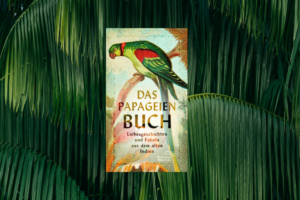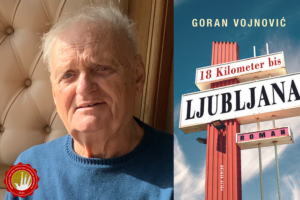Ein Autor (Mohamed Mbougar Sarr) schreibt über einen Autor (Diégane Latyr Faye), der einen Autor sucht (T. C. Elimane). Mit so einer Situation ist der*die Leser*in von Mbougar Sarrs Roman Die geheimste Erinnerung der Menschen (La plus secréte mémoire des hommes) konfrontiert, der im November 2021 mit dem Prix Goncourt, dem renommiertesten Literaturpreis Frankreichs, ausgezeichnet wurde und nun in der deutschen Übersetzung von Holger Fock und Sabine Müller vorliegt. Dies ist das vierte Buch des 32-jährigen Schriftstellers, aber das erste, das ins Deutsche übersetzt wurde. Handelten Mbougar Sarrs frühere Bücher von brisanten sozialen und politischen Themen wie dem Terrorismus bzw. Dschihadismus in der Sahelzone in Afrika (in Terre ceinte, 2015), der Migration nach Sizilien (in Silence du chœur, 2017) und der Homophobie im Senegal (in De purs hommes, 2018), widmet sich der Autor in Die geheimste Erinnerung der Menschen nun der Literatur selbst: der Produktion von Literatur und der Wahrnehmung von Literatur, der im Buch eine lebensverändernde Funktion zukommt. Das heißt aber nicht, dass sich die literarische Spurensuche, auf die sich Diégane, der Ich-Erzähler des Buches, begibt, in einer privaten, von den Turbulenzen der Gesellschaft und der Politik geschonten Sphäre abspielt. Ganz im Gegenteil: In seinem Versuch, das Leben und Werk des verschollenen, enigmatischen (fiktiven) Autors T.C. Elimane zu rekonstruieren, der in Frankreich der dreißiger Jahre mit seinem Debüt Das Labyrinth des Unmenschlichen zuerst einen großen Sog erzeugte und als „schwarzer Rimbaud“ gefeiert wurde, anschließend aber durch Plagiatsvorwürfe beseitigt wurde, stößt Diégane auf das blutige Erbe des Kolonialismus, auf rassistische Diskurse, Klischees und Gewaltstrukturen, die bis in die Gegenwart hineinwirken.
Übersetzungstechnisch hält Die geheimste Erinnerung der Menschen eine Reihe von Herausforderungen bereit, die das Übersetzerduo Holger Fock und Sabine Müller auf bewundernswerte Weise gemeistert hat. Die beiden Übersetzer*innen übersetzen seit fast 30 Jahren zusammen französische Literatur und wurden 2011 mit dem Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis ausgezeichnet. 2017 waren sie mit Kompass von Mathias Énard für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Im Fall von Die geheimste Erinnerung der Menschen hatten sie zuallererst mit einer großen sprachlichen und stilistischen Vielfalt zu kämpfen, denn Mbougar Sarrs Roman umfasst verschiedene Textsorten wie zum Beispiel Tagebuch, Brief, Bericht, Biografie, Reportage, Interview und Rezension, die in den Erzählfluss eingebettet sind und ihn unterbrechen und erweitern.
Um dieser Vielfalt gerecht zu werden, müssen die Übersetzer*innen eine hohe sprachliche Flexibilität aufweisen, also zwischen verschiedenen Sprachregistern und Tonlagen changieren und auf unterschiedliche Stilmittel zurückgreifen können. Der Schwierigkeitsgrad wird dadurch erhöht, dass manche dieser eingefügten Passagen als Fundstücke agieren, die angeblich aus einer älteren Zeit ausgegraben werden (so z. B. die Rezensionen und Artikel zu Elimanes Buch aus dem Jahr 1938), während der Haupterzählstrang der Geschichte achtzig Jahre später spielt – ein zeitlicher Unterschied, der sich nicht nur in der Historizität der Sprache niederschlägt, sondern auch in ihrer Wirkung. In vielen dieser Passagen wird nämlich eine rassistische Sprache eingesetzt, deren Übertragung eine besondere Herausforderung für Fock und Müller darstellt, wie die folgenden Beispiele deutlich zeigen:
Soyons francs: on se demande si cette œuvre n’est pas celle d’un écrivain français déguisé. On veut bien que la colonisation ait fait des miracles d’instruction dans les colonies d’Afrique. Cependant, comment croire qu’un Africain ait pu écrire comme cela en français? […] Il reste maintenant à découvrir qui se cache derrière cet étrange nom: T.C. Elimane. S’il s’agit, improbablement, d’un des nègres de nos colonies, il y aurait là de quoi commencer à croire à la puissante magie qu’ on leur prête.
Offen gestanden: Man fragt sich, ob dieses Werk nicht aus der Feder eines französischen Schriftstellers stammt, der sich hinter einem Pseudonym versteckt. Gerne räumen wir ein, dass die Kolonialisierung einige Bildungswunder in den Kolonien Afrikas vollbracht hat. Aber wer glaubt, dass ein Afrikaner imstande sein könnte, ein Buch wie dieses auf Französisch zu schreiben? […] Bleibt noch herauszufinden, wer sich hinter diesem seltsamen Namen verbirgt: T. C. Elimane. Wenn es sich, was unwahrscheinlich ist, um einen Neger aus unseren Kolonien handelt, hätte man allen Grund, an den mächtigen Zauber zu glauben, den man ihnen nachsagt.
Ce livre est la bave d’un sauvage qui, se prenant pour le maître-artificier d’une langue dont il ne domine qu’insuffisamment le feu subtil, finit par s’y brûler les ailes. […] La barbarie des Africains n’est pas qu’imaginaire […]. Toutes ces pages sans grâce montrent que la civilisation n’a pas encore pénetré les veines de ces négrillons, qui ne sont bons qu’à piller, ripailler, trousser, brûler, s’enivrer, forniquer, idôlatrer des arbustes, tuer […]
Das Buch ist der Geifer eines Wilden, der sich für den Pyrotechniker einer Sprache hält, deren subtiles Feuer er nur unzureichend beherrscht, und der sich am Ende die Flügel daran verbrennt. […] Die Barbarei der Afrikaner ist nicht nur eine Annahme […]. All diese erbarmungslosen Seiten zeigen, dass noch keine Kultur in den Adern dieser Negerlein fließt, die zu nichts taugen als zu Plünderung, Völlerei, Weiberjagd, Brandschatzung, Trunkenheit, Unzucht, Anbetung von Sträuchern, Tötung […]
In beiden Zitaten kommt eine unverhohlen rassistische Einstellung einerseits ganz offensichtlich durch das N‑Wort und andererseits durch eine gehobene, elaborierte Sprache zum Ausdruck, die auf zweierlei Weise funktioniert: Im ersten Beispiel wird Bewunderung für das Buch ausgedrückt, wobei die Identität des Autors in Frage gestellt wird (denn ein schwarzer Autor könne nicht, so der Redakteur des Artikels, imstande sein, ein solches Buch zu schreiben). Im zweiten Beispiel werden dagegen die schriftstellerischen Fähigkeiten des Autors höhnisch denunziert und mit einer äußerst abwertenden, klischeehaften Sicht auf Schwarze Menschen verknüpft. In der deutschen Übersetzung werden die stilistischen Merkmale des Originaltextes noch weiter zugespitzt. Zum einen wird der pseudo-intellektuelle Ton der Sprache noch mehr betont, wie zum Beispiel am Anfang des ersten Zitats: Im deutschen Text steht hier „ob dieses Werk nicht aus der Feder eines französischen Schriftstellers stammt, der sich hinter einem Pseudonym versteckt“, wobei an der gleichen Stelle der französische Text knapper und weniger eloquent formuliert ist: „si cette œuvre n’est pas celle d’un écrivain français déguisé“, was bei einer wortwörtlichen Übertragung so viel wie „ob es sich bei diesem Werk nicht um das eines verkleideten/versteckten französischen Schriftstellers handelt“ heißen würde. Zum anderen werden die rassistischen Formulierungen akkurat ins Deutsche übertragen, an manchen Stellen ist der Impact der rassistischen Sprache im deutschen Text sogar heftiger als im Französischen. Ein gutes Beispiel dafür liefert das Ende des zweiten Zitats, wo die Ersetzung der Infinitive („piller, ripailler, trousser, brûler, s’enivrer, forniquer, idôlatrer des arbustes, tuer“) durch Substantive („Plünderung, Völlerei, Weiberjagd, Brandschatzung, Trunkenheit, Unzucht, Anbetung von Sträuchern, Tötung“) und die gezielte Wortwahl einen strengeren und dafür stärker abwertenden Ton im Deutschen produziert.
Nicht zuletzt wird die rassistische Wirkung der Sprache in der deutschen Übersetzung durch die Verwendung – analog zum französischen Original – des N‑Worts ausgelöst, das im Buch nicht nur an diesen beiden Stellen, sondern mehrfach vorkommt. Wie die beiden Übersetzer*innen bei einer Veranstaltung am 24.11.2022 im Literarischen Colloquium Berlin (eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist hier online verfügbar) erklärt haben, hatten sie sich im Kontext der heftigen öffentlichen Diskussionen der letzten Jahre in Absprache mit dem Autor dafür entschieden, das N‑Wort in der deutschen Übersetzung nur dann beizubehalten, wenn es historisch verwendet wird – wie es zum Beispiel in den oben zitierten Auszügen aus den Kritiken von 1938 der Fall ist. (Eine Ausnahme hier bildet „Rimbaud négre“, das von Fock und Müller mit „schwarzer Rimbaud“ übersetzt wird.) Das scheint deswegen eine total sinnvolle Entscheidung zu sein, weil in diesen Fällen gerade die rassistische Performanz der Sprache thematisiert wird.
Neben all diesen (fiktiven) „historischen Quellen“ enthält der Roman von Mbougar Sarr zahlreiche offene oder versteckte Zitate und Verweise auf eine Reihe von Autoren (von Hugo und Mallarmé bis hin zu Bolaño und Kundera), die eine intensive Recherchearbeit seitens der Übersetzer*innen erfordert, wie man aus der Nachweisliste schließen kann, die Fock und Müller erstellt haben und die am Ende des Buches abgedruckt ist. Dass die Erzählung in Die geheimste Erinnerung der Menschen trotz all dieser Unterbrechungen so gut fließt, ist zweifellos eine Errungenschaft von Mbougar Sarr, der es schafft, eine tiefgründige Reflexion über Literatur und Identität, über Schreib- und Leseobsessionen und rassistische Zuschreibungen mit einer fesselnden Krimi-Geschichte zu verbinden, die sich auf drei Kontinenten abspielt – und die eine*n auf den ersten Blick an die zwei legendären Romane von Roberto Bolaño erinnern mag: Die wilden Detektive und 2666. Der eigentliche Einfluss von Bolaño auf Mbougar Sarr sollte aber nicht in der Handlung oder der Struktur gesucht werden, denn er findet vielmehr auf einer tieferen Ebene statt: In der Art und Weise, wie sich Literatur und Leben zu einer explosiven Mischung zusammenfügen, die eine Prosa hervorbringt, die sich durch ihren Humor, ihre überraschende Lebendigkeit und ihre Klarheit auszeichnet, die völlig in der Realität verwurzelt ist und sie doch transzendiert, die anspruchsvoll und doch unterhaltsam ist. Diese feine Balance zwischen Einfachheit und Komplexität, zwischen Reflexion und ungehindertem Erzählfluss spiegelt sich sowohl im Großen (im gesamten Anliegen und in der Gesamtkonstruktion des Buches) als auch im Kleinen wider: im Rhythmus von Mbougar Sarrs Prosa sowie in der Art und Weise, wie er seine Sätze und Absätze aufbaut.

Dem ausgeprägten Sprachgefühl und der sorgfältigen Arbeit von Fock und Müller ist zu verdanken, dass diese Balance (die natürlich innerhalb eines Spannungsfelds erfolgt) in der deutschen Übersetzung des Buches erhalten bleibt. Der Balanceakt bedeutet manchmal, zwischen zwei Polen oszillieren zu müssen, das heißt, gelegentlich einen Spagat auszuführen, beispielsweise zwischen einem Satz, der sich in manchen Fällen über mehrere Seiten ausstreckt, und der Knappheit einer SMS.
Folgender Auszug, der einem einzigen, drei Seiten langen Satz entnommen ist, der die leidenschaftliche Diskussion zwischen dem Protagonisten Diégane und einem mit ihm befreundeten Autor über die frankophonen afrikanischen Autor*innen der früheren Generationen wiedergibt, verdeutlicht einige der oben genannten Elemente des Schreibstils von Mbougar Sarr und unterstreicht zugleich die Qualität der Übersetzungsleistung:
(…) nous les tenions pour responsables du mal qui nous frappait: le sentiment d’être incapables ou de n’avoir pas le droit (s’était pareil) de dire d’où nous venions; puis nous les accusions de s’être laissé enfermer dans le regard des autres, regard-guêpier, regard-filet, regard-marécage, regard-guet apens qui exigeait d’eux, à la fois, qu’ils fussent authentiques – c’est-à-dire différents – et pourtant similaires – c’est-à-dire compréhensibles (autrement dit, encore: commercialisables dans l’environnement occidental où ils évoluaient); notre lancée critique était bonne, c’est-à-dire impitoyable, et nous ne devions pas nous arrêter en si bon chemin, donc nous déplorions que certains d’entre nos anciens aient versé dans les négreries de l’exotisme complaisant et d’autres dans les autofictions où ils n’arrivaient pas à transcender leur petite existence, eux qu’ on sommait d’être africains mais de ne l être pas trop et qui, pour obéir à ces deux impératifs aussi absurdes l’un gue l’autre, oubliaient d’être des écrivains, ce qui était une faute capitale (…)
(…) außerdem beschuldigten wir sie, sie hätten sich einfangen lassen im Blick der anderen, im Wespennestblick, Reusenblick, Sumpfblick, Fallenstellerblick, der von ihnen verlangte, dass sie zugleich authentisch — das heißt anders — und dennoch ähnlich — das heißt verständlich — waren (besser gesagt, dass sie in der weiten westlichen Welt, in der sie sich bewegten, noch vermarktet werden konnten); unsere kritische Verve war gut, das heißt gnadenlos, und da wir so gut unterwegs waren, durften wir nicht auf halbem Weg stehen bleiben, deshalb beklagten wir, dass einige unserer Vorgänger in die Négreries eines gefälligen Exotismus verfallen waren, andere in Autofiktionen, ohne dass es ihnen gelungen wäre, sich über ihre kleine Existenz hinwegzusetzen, und dass sie sich in die Kategorie »afrikanisch« hatten einreihen lassen, obgleich sie es nicht allzu sehr waren, dass sie, um diesen beiden gleichermaßen absurden Anforderungen zu genügen, vergessen hatten, dass sie Schriftsteller waren, ein grundlegender Fehler (…).
Wie im französischen Original wird auch in der deutschen Übersetzung die komplexe Satzkonstruktion der Passage durch die große sprachliche Präzision, die gute Organisation des sprachlichen Materials und die Verknüpfung der einzelnen Satzteile ausgeglichen. Bewahrt wird auch der schwungvolle Rhythmus des Originaltextes, der trotz der vielen eingeklammerten oder zwischen doppelten Gedankenstrichen eingefügten Zusätze für einen ununterbrochenen Erzählfluss sorgt. Eine Mischung aus gehobener („kritische Verve“) und alltäglicher Sprache („da wir so gut unterwegs waren“) reproduziert den charakteristischen, leicht selbstironischen Ton des Originals. Auch bei der Bildung der Neologismen am Anfang des Zitats beweisen Fock und Müller ihr geschärftes Sprachgefühl und ihren Einfallsreichtum: „Wespennestblick“ und „Sumpfblick“ geben buchstäblich die französischen „regard-guêpier“ bzw. „regard-marécage“ wieder, wobei „Reusenblick“ und „Fallenstellerblick“ ebenso treue, aber freiere und auf Deutsch wirksamere Lösungen für „regard-filet“ (filet=Netz) bzw. „regard-guet apens“ (guet apens=Hinterhalt) sind.
Eine weitere Besonderheit des Schreibstils des Autors und des Aufbaus des Buches besteht in der Einbettung von Geschichten in Geschichten, von Erzählungen in Erzählungen: Eine Figur erzählt, was ihr eine zweite Figur einst erzählte, die wiederum die Erzählung einer dritten Figur nacherzählte. Man braucht nicht extra zu betonen, was für eine Aufmerksamkeit diese Technik von den Übersetzer*innen erfordert, die dafür sorgen müssen, die Stimmen und deren Erzählton voneinander zu unterscheiden oder auch auf die manchmal bewusst diffusen Übergänge zwischen direkter und indirekter Rede und die unklaren Zwischenzonen zu achten. Dieses Stimmengewirr wird vom Protagonisten Diégane folgendermaßen thematisiert:
Je fernai les yeux. Une voix se mit à parler. Je ne sus si c’était celle de Siga D. ou celle de son père qui, du canapé, voulait raconter lui-même sa propre histoire. Je ne sus si nous étions toujours dans le salon de la première, à Amsterdam, ou dans la chambre puante du second. Mais pourquoi fallait-il que nous soyons nécessairement dans un lieu précis, où une voix identifiée nous parlerait, à un moment clairement défini? Nous nous trouvons toujours, dans un récit – mais peut- être, plus généralement, à tout moment de notre existence – entre les voix et les lieux, entre le présent, le passé, le futur.
Ich schloss die Augen. Eine Stimme begann zu sprechen. Ich wusste nicht, ob es die Stimme Siga D.’s oder die ihres Vaters war, der vom Sofa aus seine Geschichte selbst erzählen wollte. Ich wusste nicht, ob wir noch in Siga D.’s Wohnzimmer in Amsterdam oder im stinkenden Schlafzimmer ihres Vaters waren. Aber mussten wir denn unbedingt an einem bestimmten Ort sein, wo zu einem festgelegten Zeitpunkt eine namentlich ausgewiesene Stimme zu uns sprach? In einer Erzählung befinden wir uns immer — aber vielleicht, allgemeiner, auch zu jedem Zeitpunkt unserer Existenz — zwischen den Stimmen und den Orten, zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft.
Inspiriert vom Fall des Autors Yambo Ouologuem (1940–2017) aus Mali, der 1968 seinen Debütroman Le devoir de violence (Das Gebot der Gewalt) in Frankreich vorlegte und dafür den Prix Renaudot gewann, sich nach Plagiatsvorwürfen aber nach Mali zurückzog und keine Zeile mehr schrieb, und dem Die geheimste Erinnerung der Menschen gewidmet ist, zeigt Mohamed Mbougar Sarr in seinem Buch, wie rassistische Sprache eingesetzt wird, um einen Menschen und eine*n Künstler*in zu entwürdigen und letztendlich mundtot zu machen. Oder, wie die Verlegerin Thérèse Jacob, die zusammen mit ihrem Partner Charles Ellenstein 1938 das umstrittene Buch Das Labyrinth des Unmenschlichen von T.C. Elimane herausbrachte, Jahre später in einem Gespräch mit der Literaturkritikerin Brigitte Bolème auf den Punkt bringt:
Même aujourd’hui, dix ans après, vous ne comprenez pas. Ce qui l’a chagriné, c’est que vous ne l’ayez pas vu comme écrivain, mais comme phénomène médiatique, comme nègre d’exception, comme champ de bataille idéologique. Dans vos articles, peu ont paré du texte, de son écriture, de sa création. (…) Vous l’avez exposé; pas comme un écrivain talentuex, mais comme on expose un homme dans un zoo humain. Comme l’objet d’une avilissante curiosité. C’est aussi pour ça qu’il ne pouvait pas se montrer. Vous l’avez tué.
Selbst heute, zehn Jahre später, versteht ihr ihn nicht. Betrübt hat ihn vor allem, dass ihr ihn nicht als einen Schriftsteller, sondern als ein Medienereignis, einen Ausnahme-Schwarzen, als ein ideologisches Kampffeld gesehen habt. Wenige schrieben über den Text, seine Schreibweise, seinen schöpferischen Inhalt. (…) Ihr habt ihn nicht als talentierten Schriftsteller präsentiert, sondern wie ein Ausstellungsobjekt in einem Menschenzoo. Herabgewürdigt zu einer Kuriosität. Auch deshalb konnte er sich nicht zeigen. Ihr habt ihn erledigt.
Trotz der aufeinanderfolgenden Enthüllungen und Entdeckungen seitens des Protagonisten bleibt T.C. Elimane, der Autor, der ihn bei der ersten Lektüre so sehr in seinen Bann zog und ihn seitdem nicht mehr losließ, nicht greifbar. Sehr greifbar ist dagegen die Übersetzer*innen-Leistung: Holger Fock und Sabine Müller haben es geschafft, die verschiedenen Schwierigkeiten dieses sprachlich sehr anspruchsvollen Romans zu überwinden, seiner Vielfalt gerecht zu werden und einen literarisch wirksamen, mitreißenden deutschen Text zu liefern.