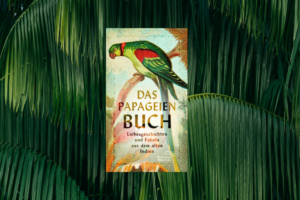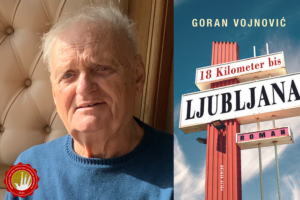Hinweis: Die Rezension enthält kleine Spoiler.
Übersetzende sind selten die Held:innen der Geschichte. Mit Ausnahme einiger Überflieger wie Luther oder Erasmus sind sie in der Geschichtsschreibung oftmals Randfiguren, die zwar auf ihre Weise eine essentielle Funktion haben, aber in vielen Fällen im Schatten anderer Entscheidungsträger agieren. Doch die Rolle der Übersetzenden verändert sich zunehmend, nicht zuletzt weil auch die Forderungen nach Sichtbarkeit immer lauter werden. Im englischsprachigen Ausland beispielsweise, wo sich Tausende auf YouTube Videos mit Empfehlungen von übersetzten Büchern anschauen, ist das Interesse an übersetzter Literatur und an der Arbeit an Übersetzenden merklich gewachsen.
Dass sich die junge Fantasy-Autorin Rebecca F. Kuang also entschied, Übersetzende zu den Protagonist:innen ihres neuesten 700 Seiten langen Romans zu machen, mag also mit Blick auf die Literaturgeschichte überraschen, ist aber durchaus naheliegend. Denn Kuang zeigt auf geniale Art und Weise, welche thematische Relevanz das Thema Übersetzung auch für jüngere Generationen hat und wie das Übersetzen von zentraler Bedeutung für aktuelle Diskurse ist. In England und den USA wurde ihr Ansatz begeistert rezipiert, zumindest legt das der Bestseller-Status des Buches nahe.
Ihr historischer Fantasy-Roman Babel, übersetzt von Alexandra Jordan und Heide Franck, mischt Dark-Academia-Ästhetik mit Wokeness und Übersetzungstheorien mit postkolonialen Debatten. Wer viel Zeit im Internet verbringt, ist all diesen Elementen mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal begegnet. In Kombination funktionieren sie zumindest in der ersten Hälfte des Romans erstaunlich gut und sorgen für einen höchst unterhaltsamen Ritt durch ein semi-fiktives England der 1830er-Jahre.
Der Held des Romans, Robin Swift, wird als kleiner Junge von dem undurchschaubaren Professor Lovell aus Canton nach England gebracht, nachdem seine Mutter an Cholera gestorben ist. In London wird ihm innerhalb kurzer Zeit Latein und Altgriechisch eingeprügelt, damit er in Oxford sein Studium am Königlichen Institut für Übersetzung, Babel genannt, antreten kann. Dort lernt er drei Mitstudierende kennen – Ramy, der in Kalkutta aufwuchs, aber sein Heimatland verließ, um eine Ausbildung in England zu erhalten; Victoire, die auf Haiti geboren wurde, aber mit ihrer Mutter nach Frankreich flüchten musste, und Letty, Offizierstochter und die einzige Britin.

Robin, Ramy und Victoire vereint nicht nur das Studium der Übersetzung, sondern auch die Erfahrung des Aufwachsens in unterschiedlichen Kulturen und des Andersseins im vermeintlich weißen britischen Königreich. Die Übersetzungsstudierenden existieren in einer Art Zwischenraum – England ist nicht ihr Heimatland, aber Oxford ein Zuhause, und Frauen und People of Colour dürfen in Kuangs Welt (anders als im realen Oxford des 19. Jahrhunderts) zumindest im babylonischen Turm studieren, aber vollwertige Studierende sind sie dennoch nicht. In Oxford können einige von ihnen hin und wieder die damalige gesellschaftliche Norm performen (Robin geht manchmal als Weißer durch und Victoire verkleidet sich als Mann), aber sie sind natürlich trotzdem Alltagsrassismus und struktureller Diskriminierung ausgesetzt, die Babel als Institut nicht besonders ernst nimmt. In England zu leben bedeutet für sie zu übersetzen, also zwischen verschiedenen Kulturen und Identitäten zu navigieren.
Das Übersetzen hat in Babel jedoch nicht nur individuelle Dimensionen. Das Königliche Institut für Übersetzung steht klar im Dienste der Krone und deren imperialen Ambitionen. Übersetzen ist demnach ein hochpolitisches Unterfangen, was Robin bereits als Kind in Kanton lernen muss. Dort soll er zwischen einem chinesischen Arbeiter, der einen Vertrag mit dem Schiff hat, und dem Schiffspersonal, das ihn nicht an Bord lassen will, vermitteln:
Professor Lovell was at his side, gripping his shoulder so tightly it hurt. ‘Translate, please.’ This all hinged on him, Robin realized. The choice was his. Only he could determine the truth, because only he could communicate it to all parties. But what could he possibly say?
Professor Lovell war an seiner Seite, und sein eiserner Griff an Robins Schulter schmerzte. »Bitte übersetze.« Es hing alles von ihm ab, erkannte Robin, und er hatte die Wahl. Es lag an ihm, die Wahrheit festzulegen, denn nur er konnte mit allen Parteien kommunizieren. Doch was sollte er sagen?
Übersetzen wird für Robin zu einem moralischen Dilemma, denn er versteht, dass dem chinesischen Arbeiter Unrecht getan wird. Gleichzeitig ist ihm aber seine Abhängigkeit von Professor Lovell (der an vielen Stellen als Symbolfigur für das britische Weltreich fungiert) bewusst. Das ist einer der Hauptkonflikte des Romans: Auf wessen Seite steht Robin? Auf der seines Heimatlandes, das vom britischen Königreich ausgebeutet wird oder auf der seiner neuen Heimat, die ihm Bildung, Nahrung und eine Zukunft bietet – natürlich nicht ohne dafür einen hohen Preis zu verlangen.
In Oxford lernt Robin zunächst, was Übersetzen in technischer Hinsicht bedeutet und welche beruflichen Möglichkeiten es gibt (ja, auch Literatur:übersetzerinnen kommen vor). Die Autorin reißt vor allem in der ersten Hälfte eine Vielzahl übersetzerischer Fragen an, die sich fließend in das universitäre Setting einbetten lassen und vor allem über Professorenrede vermittelt wird: Wie stark muss ein Text verfremdet werden, um in einer anderen Kultur verstanden zu werden? Wie sichtbar sollten die Übersetzenden im Text sein? Welche Rolle spielt Übersetzung in der Gesellschaft? Kuang scheut sich nicht davor, hin und wieder etwas in die Tiefe zu gehen und an einigen Stellen auch ein wenig Übersetzungsgeschichte, die mit einem noch ertragbaren Name-Dropping einhergeht, einzustreuen.
Doch die Kunst des Übersetzens bot der Autorin wohl nicht genug Stoff. Es stellt sich schnell heraus, dass die Professor:innen in Oxford nicht nur übersetzen, sondern „silberwerken“: „Wir sind hier, um mit Worten Magie zu wirken“, wird in der Einführungsveranstaltung verkündet – und wie so vieles in diesem Roman meint Kuang das wortwörtlich. Das britische Weltreich stellt Silberbarren her, die magische Funktionen besitzen, sofern sie mit der richtigen Wortkombination aus verschiedenen Sprachen versehen sind. Magie entsteht, weil zwischen den Wortpaaren immer eine Art Reibung besteht, denn auch wenn sich Wörter in ihrer Bedeutung ähneln, haben sie in unterschiedlichen Sprachen fast nie exakt dieselbe Bedeutung. Auf dieses Konzept müssen sich Leser:innen einfach einlassen. Hier ein Beispiel:
‘Pocket,’ Griffin gasped. ‘Front pocket—’ Robin rooted through his front pocket and pulled out a thin silver bar. ‘Try that – I wrote it, don’t know if it’ll—’ Robin read the bar, then pressed it against his brother’s shoulder. ‘Xiū,’ he whispered. ‘Heal.’ 修. To fix. Not merely to heal, but to repair, to patch over the damage; undo the wound with brute, mechanical reparation. The distortion was subtle, but it was there, it could work.
»Tasche«, keuchte Griffin. »Vordere Tasche …« Robin durchwühlte seine Tasche und zog einen dünnen Silberbarren hervor. »Versuch’s – hab ich geschrieben, weiß nicht, ob es …« Robin las die Inschrift, dann drückte er seinem Bruder den Barren auf die Schulter. »Xiū«, flüsterte er. »Heal.« Heile. 修. Reparieren. Nicht nur heilen, sondern das Loch flicken; die Wunde mit stumpfer, mechanischer Ausbesserung beseitigen. Es war nur eine unterschwellige Bedeutungsverzerrung, doch sie war da, es konnte klappen.
Dieses Silberwerken dient nicht nur als Hilfsmittel in brenzligen Situationen, sondern der Aufrechterhaltung der britischen Infrastruktur – es lässt Uhren schlagen, Züge rollen und Krankheiten heilen. Nur Übersetzende können mit dieser Art von Magie umgehen und die britische Insel begründet ihre Vormachtstellung mit dem Handel von Silber.
Durch ihre Arbeit sollen die Studierenden das britische Königreich als führende Kolonialmacht zementieren: „Der Turm ist eng mit dem Geschäft des Kolonialismus verwoben. Er ist das Geschäft des Kolonialismus“, erklärt ein älterer Student, der für einen Geheimbund namens Hermes arbeitet. Diesem schließen sich Robin und seine Freund:innen an, um in der zweiten Hälfte – wo der konkrete Bezug zum Übersetzen deutlich nachlässt – den babylonischen Turm zu Fall zu bringen und die Ausbeutung anderer Nationen zu stoppen.
In der bedachten Übersetzung von Heide Franck und Alexandra Jordan bereitet Babel ein durchaus kurzweiliges und unterhaltsames Lesevergnügen. Die Übersetzerinnen folgen Kuangs insgesamt modernem Schreibstil, ohne übertrieben altmodisch oder gegenwartsnah zu klingen. Und auch die Dialoge klingen im Deutschen, sofern es die Vorlage hergab, ungekünstelt. Eine Herausforderung sprachlicher Natur war bei dieser Übersetzung sicherlich der Oxford-Jargon, der auch für englische Muttersprachler:innen bisweilen befremdlich und nicht immer verständlich ist. Die übersetzerischen Passagen, wo mit chinesischen, englischen, deutschen und französischen Wörtern gespielt wird, sind im Deutschen für Leser:innen, die keinen Übersetzungsbezug haben, nachvollziehbar und überfrachten den Text kaum.
Tatsächlich liegen die großen Schwächen des Romans nicht in der deutschen Übersetzung oder gar im Umgang mit übersetzerischen Themen. Vielmehr sind sie erzählerischer und stilistischer Natur. Die Autorin fügt auf so stumpfe Art und Weise Erläuterungen und mitunter triviale Fakten ein, dass man ihr einen Schreibratgeber reichen möchte. Zum Beispiel an dieser Stelle:
‘A wine party, and then what?’ Ramy persisted. ‘You think they’ll make you one of the lads? Are you hoping they’ll take you to the Bullingdon Club?’ The club on Bullingdon Green was an exclusive eating and sporting establishment where young men could while away the afternoon hunting or playing cricket. Membership was assigned on mysterious grounds that seemed to strongly correlate with wealth and influence.
»Und was passiert danach?«, bohrte Ramy nach. »Glaubst du, sie nehmen dich in ihren Zirkel auf? Hoffst du, dass sie dich mit in den Bullingdon Club nehmen?« Der Club am Bullingdon Green war ein exklusives Restaurant mit Sportverein, in dem junge Männer den Nachmittag auf der Jagd oder beim Cricket verbringen konnten. Die Mitgliedschaft wurde nach mysteriösen Kriterien vergeben, die stark mit Reichtum und Einfluss zusammenzuhängen schienen.
Statt Anspielungen einfach Anspielungen sein zu lassen, erklärt Kuang den Lesenden, was es mit diesem real existierenden Club, dem bekanntermaßen ehemalige Premierminister wie Boris Johnson angehörten, auf sich hat, ohne dass dieser Club von Relevanz für die Handlung wäre. Solche Passagen sind keine Ausnahme: Offenbar beherrscht die Autorin keine andere Technik, um die Lesenden mit Zusatzinformationen zu versorgen. An anderer Stelle lässt die Autorin beispielsweise eine Figur den Sinn und Zweck eines Sitzstreiks erläutern, was wie aus einem Geschichtsbuch abgeschrieben klingt. Und wenige Seiten später erklärt ein Student komischerweise, dass Frankreich im 19. Jahrhundert Vorreiter auf dem Gebiet der Übersetzung war, dabei spielt die Handlung des Romans in den 1830er Jahren.
Noch viel fragwürdiger ist allerdings die eindimensionale Figurenzeichnung, die sich auf zuweilen absurde Handlungsmotive stützt. Die blass gezeichnete Letty beispielsweise, die vorher keine großen Aggressionen gezeigt hat, greift in einem zweifelhaften Plottwist zur Waffe, weil Ramy nicht mit ihr auf einem Ball tanzen wollte und sie sich als „reiches weißes Mädchen“ der eigenen Rassismen nicht bewusst ist: „Ein brauner Mann verschmäht eine englische Rose. Das hat Letty nicht ertragen. Die Demütigung.“ Und ein Professor wird mit einem Silberbarren getötet, die er dem Täter vorher praktischerweise und in höchst offensichtlicher Manier in die Hand gedrückt hat, was aufmerksamen Lesenden mit Sicherheit nicht entgangen ist.
Der Roman kaut seinen Leser:innen vor, was sie über die Figuren zu denken haben, ohne aber genügend Handlung zu bieten, aus der man eigene Schlüsse ziehen könnte. Statt der Komplexität Raum zu geben, die durch die engen Verwicklungen persönlicher und politischer Interessen, durch Eigenverantwortung und Fremdbestimmung entsteht, bricht Kuang den Konflikt an vielen Stellen auf ein schwarz-weiß Schemata herunter. Wer hier die Guten sein sollen und wer die Bösen, wird in dem Roman recht schnell klar. Wenn der reale Verlauf der Geschichte tatsächlich immer so geradlinig gewesen wäre und der Mensch kein widersprüchliches Wesen – doch genau das macht Kuangs Roman zur Fantasy.
In dieser Fantasie ist Gewalt die einzig angemessene Lösung, da das britische Königreich seine Herrschaft durch brutale Unterdrückung und die Androhung von Krieg ausweiten will. Der Feind ist nur durch seine eigenen Mittel zu schlagen, denn „Gewalt zeigt ihnen, zu welchen Opfern wir bereit sind“, erklärt ein Mitglied des Geheimbunds dem mitunter blauäugigen Robin, der wiederum den Moment mit der Pistole in der Hand genießt: „die Macht, die er mit einem Zucken seines Fingers ausübte – das fühlte sich gut an“. Passend dazu lautet der gesamte Titel der englischsprachigen Ausgabe wie folgt: Babel. Or the Necessity of Violence: An Arcane History of the Oxford Translators’ Revolution. In der deutschen Fassung hat man getrost auf diesen Zusatz verzichtet.
Nicht alle sind so gewaltbereit wie Robin, aber dass die Gewalt auch gegenüber der Zivilgesellschaft notwendig ist, um überhaupt eine Chance gegenüber dem Establishment zu haben, wird kaum signifikant angezweifelt. Robins moralischer Kompass ist schließlich the greater good. Dass er zwar in vielerlei Hinsicht Opfer, gewissermaßen aber auch Täter ist, scheint für ihn wie auch für die Autorin kein erwähnenswertes Dilemma darzustellen. Doch der Erzfeind, das böse britische Imperium, bleibt letztlich abstrakt, weil seine Repräsentant:innen schrittweise vom Plot eliminiert werden, bevor die eigentliche Action beginnt. Das Revoluzzer-Dasein kommt in Babel also insgesamt schal daher. Bei so viel Oberflächlichkeit konnten auch die Übersetzerinnen nichts mehr retten.