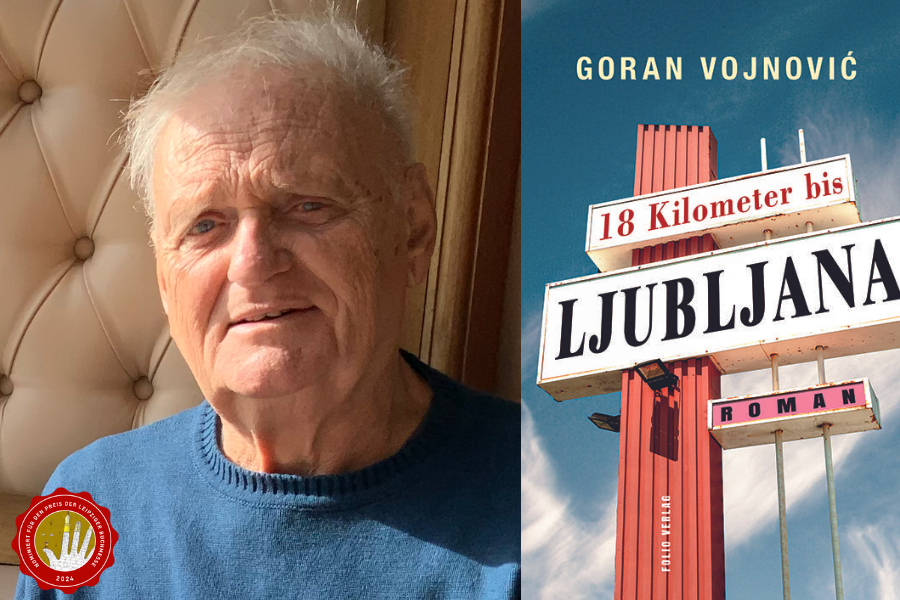Eine so berühmte wie bezeichnende Anekdote aus dem iranischen Literaturbetrieb geht wie folgt: Als das für Zensur zuständige Kulturministerium Mahmoud Doulatabadis Roman Der Colonel geprüft hatte, teilte es dem Autor mit, das Buch sei ein Meisterwerk, könne aber unmöglich publiziert werden. So wurde deutsche Übersetzung von Bahman Nirumand (Unionsverlag 2009) zur Welterstausgabe, weitere Übersetzungen auf Italienisch, Englisch, Französisch und Türkisch folgten.
Ähnlich absurd ging es bei Amir Hassan Cheheltan zu, dessen Roman Teheran, Revolutionsstraße (Deutsch von Susanne Baghestani, P. Kirchheim 2009) ebenfalls zuerst auf Deutsch, dann in zahlreichen weiteren Sprachen und schließlich erst 2022 auf Persisch erschien. Sein wohl wichtigstes Werk, Iranische Dämmerung (Deutsch von Jutta Himmelreich u. Farsin Banki; P. Kirchheim 2015), wurde 2007 mit dem staatlichen Buchpreis als ‚Buch des Jahres‘ bedacht – was Cheheltan ablehnte, er wollte keine Auszeichnung derselben Behörde, die Bücher zensiert. Doch die Antwort kam prompt: Er könne den Preis gar nicht ablehnen, denn den erhalte ja das Buch, nicht der Autor.
Alle drei Bücher befassen sich mit der iranischen Geschichte im 20. Jahrhundert, mit der Zeit der Schah-Diktatur, den Verwerfungen der Islamischen Revolution von 1979, dem blutigen Märtyrerkult im Iran-Irak-Krieg der Achtziger Jahre und den Rissen, die all das in der Zivilgesellschaft hinterlassen hat, den Rissen, die sich durch die Familien und das Leben von Grund auf verändert haben. Chehelten (*1956) und Doulatabadi (*1940) sind zwei gewichtige Stimmen der iranischen Gegenwartsliteratur, Doulatabadi einer jener Autoren, die längst den Nobelpreis hätten erhalten müssen, in Stockholm aber konsequent übergangen werden. Große Erzähler, deren Werk zwar einerseits explizit iranisch ist, andererseits aber weit über jede Regionalität hinausragt, nicht zuletzt aufgrund ihres genauen Blicks für historische und globale Zusammenhänge sowie ihrer Fähigkeit, die Detonationen des Politischen im Privaten ins Allgemeingültige zu übertragen.
Dass gleich mehrere Bücher beider Autoren auf Deutsch vorliegen, hat nicht nur mit ihrem literarischen Status zu tun, sondern auch mit ihren Themen. Wirft man einen Blick auf das, was an Übersetzungen aus dem Persischen auf dem deutschen Buchmarkt landet, fällt eine gewisse Monothematik auf: Die meisten dieser Texte sind politisch; Themen wie die Schah-Zeit und die Revolution sind überrepräsentiert, was leicht einen falschen Eindruck entstehen lassen kann, dabei liegt das an der oft recht engen Auswahl dessen, was deutsche Verlage für verkäuflich halten – Bücher, die sich möglichst explizit um Politik und Repression drehen; alles andere wird, zumindest von den notorisch mutlosen Publikumsverlagen, weitgehend ignoriert.
Die Problematik findet sich bei vielen nichtwestlichen Literaturen. „Mit deutschen Verlagen ist es schon tragisch“, sagt der Übersetzer Mahmoud Hosseini Zad, „obwohl sie so viel größere Freiheiten haben als die Verlage in Iran. Sie wollen nur Politik. Sie haben ihre Orient-Vorstellung vom Anfang des 20. Jahrhunderts mit Harem, Sultan und Sklaven, bis heute nicht abgelegt. Sie wollen Bücher über Mullahs, Ayatollahs, Pasdaran und Gefängnisse. Heißt, sie wollen eigentlich keine Literatur.“
Weswegen es umso wichtiger ist, dass es Kleinverlage gibt, die einen anderen, weniger marktkonformen Blick haben, allen voran der Sujet Verlag, die Edition Orient, der Unionsverlag und einige weitere, denn Iran ist seit jeher eine Literaturnation – das wissen wir spätestens, seit Rückert, Hammer-Purgstall und Goethe uns den großen persischen Dichter Hafez näherbrachten. Viele der persischen Klassiker sind aus der Weltliteratur nicht wegzudenken und teils mehrfach übersetzt; neben Hafez auch Chayyam, Saadi, Firdousi (mit seinem Nationalepos Shahname, dem „Buch der Könige“).
Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war Lyrik, insbesondere epische Versdichtung, die vorherrschende literarische Form nicht nur in Iran, sondern in nahezu allen Ländern Westasiens. Sie orientierte sich an einer so kunstvollen wie strengen Form- und Bildsprache, die bis heute verstanden wird und zum Alltagsgebrauch zählt. Hafez’ ‚Diwan‘ ist das am weitesten verbreitete Buch in Iran und dürfte sich in wirklich jedem Haushalt finden. Und im Gegensatz zu Goethe hierzulande wird der Barde in Iran tatsächlich gelesen.
Die moderne Erzählprosa setzte sich erst vor rund hundert Jahren langsam durch, ein Trend, der aus Europa kam und in Iran mit Sadegh Hedayats (1903 – 1951) düsterem, wegweisenden Roman Die blinde Eule (Deutsch von Bahman Nirumand, Eichborn 1990/Suhrkamp 1997) im Jahr 1936 seinen Anfang nahm und ihm zu Recht den Ruf eines iranischen Kafka einbrachte. Zugleich machte sich eine junge Dichtergeneration um Nima Yushij (1895 – 1960) daran, die Lyrik zu erneuern, Verse in Alltagssprache und freien Formen zu verfassen.
Einer literarischen Revolution gleich kamen die Gedichte der jungen Lyrikerin Forough Farrokhsad (1935 – 1967), die offen über ihre Gefühle und Sehnsüchte als Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft schrieb und auch erotische Passagen in ihre Verse einflocht – damals ebenso Sensation wie Skandal. Auch ihre Gedichte werden bis heute gelesen. Die jungen Frauen, die seit Herbst 2022 gegen das Regime protestieren, tragen sie auf der Zunge, verewigen sie an Hauswänden. Forough Farrokhsad gilt als wichtigste iranische Lyrikerin des 20. Jahrhunderts; ein Teil ihres Werkes ist unter dem Titel Jene Tage in der Übersetzung von Kurt Scharf im Sujet Verlag erschienen. Scharf hat außerdem, zuletzt gemeinsam mit Ali Abdollahi, mehrere Anthologien herausgegeben, in denen sich die Entwicklung der iranischen Dichtung in all ihrer Vielstimmigkeit nachvollziehen lässt.
Ein Roman, der viele dieser Themen zu einem kunstvollen Netz verwebt, ist Mahmoud Doulatabadis Nilufar (Deutsch von Bahman Nirumand, Unionsverlag 2013): Ein alter Mann hinterlässt auf einer Parkbank ein Notizbuch. Gheiss, der Protagonist nimmt es an sich, stellt sich vor, wie sie es ihm vorliest, lauscht beim Lesen ihrer Stimme. Sie, das ist Nilufar. Für ihn war sie die vollkommene Frau aus den klassischen orientalischen Gedichten. Ist es ein Zufall, dass der Protagonist so heißt wie der arabische Liebesdichter al-Qais oder dass Gheiss sich angesichts Nilufar einerseits in völlige Liebesverzweiflung wirft, andererseits Mordpläne schmiedet, als sie ihn zu verlassen droht – ähnlich dem Protagonisten in Sadegh Hedayats Blinder Eule?
Nein, all das ist kein Zufall. Doulatabadi arbeitet in seinem Roman offen mit einem Geflecht aus vielschichtigen Anspielungen sowohl auf die klassische persische Literatur wie Hafez, Nizami oder Rumi als auch auf die klassische Moderne in Form von Hedayat oder Shamlu. Stefan Weidner bezeichnete Doulatabadi einmal als Epiker, vergleichbar mit Tolstoi. Im Gegensatz zum Colonel hat Nilufar eine Freigabe von der iranischen Zensurbehörde erhalten. Man muss also zwischen den Zeilen lesen, muss weiterdenken um zu sehen, worauf die Anspielungen deuten.
Wenn an bestimmter Stelle ein Weinschenk wie bei Hafez auftaucht, an anderer der Trödler von Hedayat, so geschieht das mit Kalkül. Ist es die Liebe, an der Gheiss zerbricht, der Hass oder gar die Welt, die immer bedeutungsloser wird, je näher er zu sich selbst kommt? Oder sind es doch die gesellschaftlichen Zwänge, die aus Nilufar die hinterlistige Taktiererin machen, die ihre Schwester in ihr sieht? Ist es die zwangsweise Abwesenheit des Realen, die Gheiss in die Position des leidenden Minnesängers zwingt? Und wer ist Gheiss überhaupt? Keine dieser Fragen beantwortet der Roman, und er muss es auch nicht. Er begnügt sich damit, sie zu stellen. In einer dunklen und kalten Nacht, auf den Stufen eines verschlossenen Hauses …
Einen anderen Ansatz wählt Fariba Vafi (*1963) deren Romane und Kurzgeschichten in Iran vielfach mit renommierten Preisen bedachte Bestseller sind, und von denen inzwischen fünf auch auf Deutsch vorliegen. Vafis Setting ist der Mikrokosmos Familie. Es geht in ihrer Kurzgeschichtensammlung An den Regen oder im Roman Der Traum von Tibet (beide Deutsch von Jutta Himmelreich, Sujet Verlag 2021 und 2018) um die Verwerfungen des Zwischenmenschlichen, um schwierige Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern oder Geschwistern, und über allem schwebt, meist unausgesprochen und geschickt zwischen den Zeilen (wie überhaupt das Eigentliche bei Vafi fast immer in Andeutungen bleibt, was auch der Zensur geschuldet ist) die erdrückende Enge eines Staatssystems, das tief ins Leben der Bürger*innen eingreift und Freiräume sehr eng absteckt. Wo man eine eher dunkle Stimmung erwartet, überrascht einen die Autorin mit hintersinnigem Humor und einem genauen Blick für das, was das Menschsein ausmacht.
So auch bei der Titelfigur ihres 2016 auf der Frankfurter Buchmesse mit dem LiBeraturpreis ausgezeichneten Romans Tarlan (ebenfalls übersetzt von Jutta Himmelreich, Sujet Verlag 2015): Eine junge Frau, die eigentlich Schriftstellerin werden möchte, dafür in ihrem Elternhaus in der Provinz aber keine Möglichkeit sieht, weswegen sie sich für die Polizeischule in der Hauptstadt anmeldet. Dort begegnet sie vielen jungen Frauen voller Hoffnungen und Träume, ganz normalen Teenagern, von denen viele aber bereits den Glauben an ein selbstbestimmtes Leben verloren haben, während andere kämpferisch sind und sich auch vom Drill der Ausbildung nicht entmutigen lassen wollen.
Ein großes Kunststück ist die Art, wie Vafi all das erzählt, denn nahezu der ganze Roman spielt sich im Schlafsaal der Mädchen ab, die Polizeischule selbst tritt fast nur in Form der strengen Aufseherin auf. Wer auch nur eines von Fariba Vafis Büchern gelesen hat, versteht sofort, weshalb sie in Iran so erfolgreich sind – in Deutschland müssten sie es längst ebenfalls sein. Es ist nicht nur ihre genaue und sensible Sprache, es ist auch der Blick für ihre Figuren, für emotionale Zwänge, für familiäre Verstrickungen, die zwar einerseits oft explizit iranisch sind, andererseits problemlos übertragbar an jeden anderen Ort der Welt. Man kennt diese Figuren aus dem eigenen Leben.
Die ganz junge Generation iranischer Erzähler*innen, also jene erst nach der Revolution von 1979 geborenen, sucht man auf dem deutschen Buchmarkt, auf dem kaum zwei bis drei neue Übersetzungen aus dem Persischen pro Jahr erscheinen, bislang nahezu vergeblich. Das möchte der Kölner Übersetzer und Herausgeber Arash Alborz aber mit seinem Literaturmagazin dort ändern. Inzwischen sind drei Ausgaben erschienen, jeweils mit drei Geschichten, die eines gemeinsam haben: Sie tendieren mal ernst, mal augenzwinkernd zur Weird Fiction, haben etwas Kafkaeskes an sich, wenn ihre fragilen Figuren durch eine fragile Realität wandern, in die Elemente des Phantastischen einbrechen, wenn etwa bei Masoud Riahi der Vater des Protagonisten das Geld der Familie verdient, indem er sich tagtäglich aus dem Fenster der Wohnung wirft, auf der Straße zerschellt und die Almosen der von dem Schauspiel faszinierten Passanten einsammelt – bis er sich selbst wieder einsammelt, das Blut von der Straße putzt und zum Abendessen wieder nach Hause geht. Klar, dass solches Treiben das Misstrauen der Staatsmacht erweckt …
All das lässt erahnen, welches Potential sich noch versteckt in einem Land mit einer jahrtausendalten literarischen Tradition, das heute wieder vor großen politischen Umbrüchen und womöglich einer neuen, diesmal demokratischen Revolution steht – und dem, was dort alles publiziert werden kann, sobald die Fesseln der Zensur einmal gesprengt sind. Vielleicht werden dann endlich auch die so oft verschnarchten deutschen Publikumsverlage wieder aufmerksam. Man darf ja hoffen …