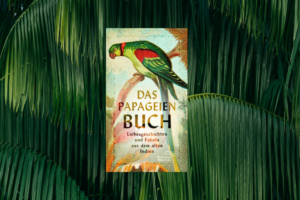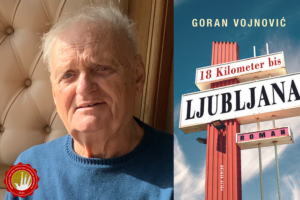Was lesen wir eigentlich, wenn wir Knut Hamsuns Hunger in deutscher Übersetzung lesen? Rein inhaltlich ist diese Frage leicht zu beantworten: Hamsuns Roman ist ein Künstlerroman über einen anonymen Ich-Erzähler, einen verkrachten Schriftsteller, der sich in Kristiania – dem heutigen Oslo – mehr schlecht als recht mit Feuilletons über Wasser hält und, wie schon im Titel angedeutet, hungern muss. Bekommt er doch einmal ein Honorar für seine Arbeit, fühlt er sich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, aber nur so lange, bis das Geld wieder ausgegeben ist.
Wenn es aber darum geht, in welcher Fassung wir den norwegischen Text – und im Zuge dessen auch seine deutsche Übersetzung – denn nun lesen wollen, wird es schnell kompliziert. In Nachschlagewerken wie Jürg Glausers Skandinavische Literaturgeschichte steht, dass der Roman 1890 veröffentlicht wurde; diese Angabe ist allerdings ungenau. Zwar erschien das Buch zum ersten Mal 1890, aber zu Knut Hamsuns Lebzeiten gab es noch einige weitere Ausgaben. Neun Jahre nach der ersten, vom Kopenhagener J. G. Philipsen Verlag publizierten Version druckte der Verlag Albert Cammermeyer die zweite. 1916, 36 Jahre vor seinem Tod, veröffentlichte der Autor in einer Werkausgabe eine Neuauflage mit weiteren inhaltlichen Änderungen, auf die 1934 eine weitere folgte, diesmal allerdings nur mit orthographischen Anpassungen seitens des Gyldendal-Verlags. Letztere gilt bis heute als die Standard-Version von Hunger. Nach Hamsuns Tod gab es noch zwei neue Editionen: Die erste, von seinen Erben autorisierte, kam 1954 auf den Markt, die zweite, die auf dem Text von 1934 beruht, 2009 – beide mit jeweils an die damals geltenden Regeln angeglichener Rechtschreibung. Die Texte von 1890 und 2009 unterscheiden sich grundlegend voneinander, denn Hamsun hat zwischen der ersten und zweiten sowie der dritten und vierten Ausgabe teils erhebliche Streichungen und Bearbeitungen vorgenommen, die die Lesart und damit auch die Übersetzung des Textes beeinflussen.
Obwohl Hamsun einer der beiden norwegischen Literaturnobelpreisträger:innen ist, gibt es noch immer keine textkritische Ausgabe. Und das, obwohl der Literaturwissenschaftler Ståle Dingstad bereits 1998 in einem Aufsatz mit dem vielsagenden Titel Über Hunger (1890) – sowie weitere Texte unter gleichem Namen fragte:
… wie viele Versionen haben wir, was unterscheidet sie voneinander, und wieso lesen wir ausgerechnet diese eine? Nicht einmal unsere universitäre Ausbildung, die bei einer wissenschaftlichen Arbeit die Angabe der verwendeten Ausgabe von uns verlangt, hat uns dazu veranlasst, den Text selbst in Frage zu stellen. Auch die institutionalisierte Forderung, zum Text selbst zu gehen, sich an ihn zu halten, ihn einer eingehenden Lektüre zu unterziehen, hat den Glauben, ein kanonischer Text stünde unumstößlich fest, nicht erschüttern können. Vielmehr hat die close reading-Strategie uns in unserem Glauben bestärkt und das Ihre dazu beigetragen, den Text zu verabsolutieren – als eine Größe, die identisch ist mit sich selbst.
Was dem Literaturwissenschaftler Dingstad Anlass zur Sorge bereitet, muss Übersetzer:innen erst recht bekümmern. Bei einem kanonisierten Text gilt normalerweise die Fassung als Vorlage, die der Autor als letzte herausgegeben hat – es sei denn, es liegt ein Sonderfall vor, schreibt Henrik Petersen im Nachwort zu seiner 2016 erschienenen schwedischen Neuübersetzung. Hunger ist definitiv ein solcher Sonderfall, denn die Unterschiede zwischen den Texten sind teilweise gravierend. Die Erstversion von 1890 eignet sich am ehesten für eine Übersetzung, da sie den Roman in seiner ursprünglichsten Gestalt bewahrt.

Marie von Borch, Hamsuns erste deutsche Übersetzerin, musste sich noch nicht fragen, welche Fassung sie nehmen sollte, denn sie übertrug den Roman fast zeitgleich mit seiner Veröffentlichung in Norwegen. Damit griff sie einen Trend auf: Um 1890 war skandinavische Literatur in Deutschland in Mode, was nicht zuletzt an Henrik Ibsens Gesellschaftsdramen lag. Die Popularität nordeuropäischer Kultur kam auch Hamsun zugute, dank des skandinavischen Künstlermilieus in Berlin wurde sein Debütroman auf Deutsch in der Zeitschrift Freie Bühne besprochen. Dort erschien auch ein Auszug in Marie von Borchs Übersetzung (ein Umstand, den man auch in norwegischen Zeitungen zur Kenntnis nahm, hatte von Borch doch bereits Ibsen erstmals ins Deutsche gebracht und so im Heimatland der beiden Dichter einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt). Diese Veröffentlichung wiederum erregte das Interesse des Verlegers Samuel Fischer. So kam es dazu, dass Hunger bereits 1891 ins Programm des Fischer-Verlags aufgenommen wurde, der sowieso schon viele skandinavische Autoren unter Vertrag hatte.
Hamsun konnte zunächst zufrieden sein, denn die Publikation gewährte ihm Zugang zu einer großen europäischen Kultursprache. Allerdings verkaufte sich Hunger recht bescheiden und er wurde zudem beschuldigt, in seiner Erzählung Hazard Dostojewskijs Spieler zu plagiieren. So kam es, dass Samuel Fischer Hamsuns zweiten Roman, Mysterien, nicht mehr veröffentlichen wollte. Die Plagiatsaffäre machte Hamsun schwer zu schaffen, und so ging er schließlich nach Paris, um Französisch zu lernen. Dort begegnete er den Dandy Albert Langen, erzählte ihm von den Querelen um seinen zweiten Roman und zeigte ihm das Übersetzungsmanuskript der Mysterien. Langen war Feuer und Flamme und bot Samuel Fischer an, für die Veröffentlichung dieses Buches aufzukommen. Die Summe war allerdings so hoch, dass er einen Rückzieher machen musste, und er spielte mit dem Gedanken, eigens für die Mysterien selbst einen Verlag zu gründen. Das tat er dann auch.
Wie sich herausstellte, war das die richtige Entscheidung. Auch nachdem Albert Langen 1909 verstorben war, veröffentlichte sein Verlag Hamsuns Bücher, darunter eine u. a. von Julius Sandmeier besorgte Sammelausgabe, die ab 1921 erschien, ein Jahr, nachdem der Autor für den Segen der Erde den Literaturnobelpreis erhalten hatte. Im Impressum zu Hunger steht allerdings nicht, welchen norwegischen Text Sandmeier seiner Übersetzung zugrunde legt. Bei einem inhaltlichen Vergleich fällt allerdings auf, dass in Sandmeiers Buch mehrere Stellen aus der Version von 1890 fehlen. Noch dazu ist bei Sandmeier eine Textstelle zu finden, die Hamsun erst ab der dritten Auflage hinzugefügt hat. Der Übersetzer hat also frühestens die Edition von 1907 verwendet, wenn nicht sogar die von 1916 Deutschsprachigen Leser:innen waren bis zu Siegfried Weibels 2009 veröffentlichter Fassung, die auf die Ausgabe von 1954 rekurriert, nur also zwei von fünf Textversionen zugänglich – nämlich Sandmeiers und Marie von Borchs.
Das ändert sich nun, da Ulrich Sonnenberg für den Manesse-Verlag eine neue Übersetzung angefertigt hat, die den norwegischen Text von 1890 zur Vorlage nimmt – und zeitgleich mit einer Neuauflage von Julius Sandmeiers Fassung bei Anaconda auf den Markt kommt. In seinem Nachwort schreibt Sonnenberg, weshalb es so wichtig ist, die allererste Ausgabe zu übersetzen: „Als Hunger 1890 erschien, war Hamsun ein dreißig Jahre alter radikaler Schriftsteller, der das irrationale Seelenleben schilderte und gegen den Realismus opponierte. Diese Version des Autors sollten wir heute lesen, nicht die des Vierundsiebzigjährigen.“
„Ich kann meine Bücher nicht mehr lesen, wenn ich mit der Korrektur durch bin, sind sie für mich gestorben“, schrieb Knut Hamsun 1926 an den schwedischen Literaturhistoriker Carl David Marcus. Aber Hamsun, der in seinen Selbstauskünften so zuverlässig unzuverlässig war wie die Erzähler seiner Romane, hat sehr wohl in den Text seines Debütromans eingegriffen. Wie Ståle Dingstad und Henrik Petersen in ihren Kommentaren anmerken, betrifft das vor allem zwei Szenen aus dem dritten Teil des Romans: Nachdem er wieder einmal festgestellt hat, dass er nach tagelangem Hungern nichts mehr bei sich behalten kann, verliert der Erzähler endgültig die Geduld und bricht in eine blasphemische Tirade aus.
Jeg siger dig, jeg vil heller være Lakej i Helvede end Fri i dine Boliger, jeg siger dig, jeg er fuld af livsalig Foragt for din himmelske Usselhed, og jeg vælger mig Afgrunden til evigt Tilhold, hvor Djævelen, Judas og Farao er stødt ned. Jeg siger dig, din Himmel er fuld af alle Jorderigets mest raahovede Idioter og fattige i Aanden, jeg siger dig, du har fyldt din Himmel med de fede, salige Horer hernedefra, som ynkeligen har bøjet Knæ for dig i sin Dødsstund. […] Jeg siger dig, hele mit Liv, hver Celle i min Krop, hver Evne i min Sjæl gisper efter at haane dig, du naadefulde Afskum i det høje. Jeg siger dig, jeg vilde, om jeg kunde, raabe dette højlydt ind i din Himmel og hen, over den hele Jord, jeg vilde, om jeg kunde, aande det ind i hver ufødt Menneskesjæl, som engang kommer paa Jorden, hver Blomst, hvert Blad, hver Draabe i Havet. Jeg siger dig, jeg vil spotte dig ud paa Dommens Dag og bande dig Tænderne ud af min Mund for din Guddoms endeløse Ynkelighed.
(Knut Hamsun, 1890)
Lass dir sagen, lieber wäre ich ein Lakai in der Hölle als ein freier Mann in deinen Wohnungen; lass dir sagen, ich bin voller glückseliger Verachtung deiner himmlischen Erbärmlichkeit, und ich erwähle mir den Abgrund als ewigen Aufenthaltsort, in den der Teufel, Judas und Pharao hinabgestoßen wurden. Lass dir sagen, dein Himmel ist voll der schwachköpfigsten Idioten und Armen im Geiste, lass dir sagen, du hast deinen Himmel mit fetten, seligen Huren von hier unten angefüllt, die in ihrer Todesstunde erbärmlich die Knie für dich gebeugt haben. Lass dir sagen, mein ganzes Leben, jede Zelle meines Körpers, alle Seelenkräfte sind begierig darauf, dich zu verhöhnen, du gnadenvoller Abschaum in der Höhe. Lass dir sagen, wenn ich könnte, würde ich all dies lautstark in deinen Himmel und über die ganze Erde schreien, wenn ich es könnte, würde ich dies jeder ungeborenen Menschenseele einhauchen, die irgendwann einmal auf die Welt kommt, jeder Blume, jedem Blatt, jedem Tropfen im Meer. Lass dir sagen, ich will dich am Tag des Jüngsten Gerichts verspotten und mir die Zähne aus dem Mund fluchen über die grenzenlose Erbärmlichkeit deiner Gottheit.
(Ulrich Sonnenberg, 2023)
Wie Henrik Petersen im Nachwort zu seiner Übersetzung erläutert, entfernt Hamsun in der Fassung von 1899 zwei Passagen aus dem gotteslästerlichen Monolog seines Protagonisten und ersetzt sie durch eine neue, die deutlich gekürzt ist. Die folgenden Zeilen sind dementsprechend nur bei Sandmeier, nicht aber bei Sonnenberg zu lesen:
Burde du ikke vide det? Danned du mit Hjærte i Søvne? Jeg siger dig, hele mit Liv og hver Blodsdraabe i mig glæder sig over at haane dig og bespytte din Naade.
(Knut Hamsun, 1899)
Musstest du das nicht wissen? Hast du mein Herz im Schlaf gebildet? Ich sage dir: mein ganzes Herz und jeder Blutstropfen in mir freut sich darüber, dich zu verhöhnen und deine Gnade zu bespeien.
(Julius Sandmeier, 1921/2023)
Wieso Hamsun diese zwei Passagen gestrichen hat, ist unklar. Zwar schreibt Dingstad, der Autor habe die Auflage von 1899 vor der Drucklegung noch einmal gelesen, aber er habe sich nicht dazu geäußert, welche Änderungen er genau eingefügt habe, nur, dass er den Roman noch einmal durchgegangen sei. Vielleicht hat Hamsun mit den Streichungen aber auf negative Rezensionen reagiert. So schrieb am 16.06.1890 ein Kritiker im Kopenhagener Dagbladet, Hamsun sei zwar der erste Skandinavier, der es mit Dostojewskij aufnehmen könne, allerdings sei Hunger eher eine „Materialsammlung“ als ein Roman: Er sei unsittlich, ansonsten aber passe das Buch gut zu aktuellen Tendenzen im Kulturbetrieb (was nicht als Kompliment gemeint ist): „Das Bedauerlichste an dem Buch ist, dass sein Autor ab und an offenbar in voller Absicht zynische Worte und Bilder verwendet, auch erregen die oftmals blasphemischen Anrufungen Gottes und die bohèmehafte Derbheit, die etliche Seiten dieses Buches besudelt, zweifellos die Abscheu gebildeterer Leser.“
Auch wenn Hamuns Debütroman und seine Darstellung von Hunger und Armut vielerorts gut aufgenommen wurden, wäre es nicht verwunderlich, wenn ihn eine derart moralinsaure Kritik zur Streichung vermeintlich blasphemistischer und pornographischer Passagen veranlasst hätte. Vielleicht aber gab Hamsun auch recht wenig auf Verrisse wie diesen und er sah seinen Text Jahre nach dessen Veröffentlichung schlichtweg mit frischem Blick. Hamsun sagte gerne das eine und tat dann doch das andere: weswegen es schwierig ist, den genauen Grund für die Streichungen zu ermitteln. Bei einer Prüfung der gestrichenen Passagen zeigt sich schnell, wie unterschiedlich die Fassungen oft sind – oft auch in ihrer Übersetzung. Würde Sandmeiers Version einem kritischen Blick heutzutage überhaupt noch standhalten? Oder gilt vielmehr, was oft auf Übersetzungen klassischer Texte zutrifft – die Vorlage, ganz gleich, in wie vielen Fassungen sie auch existiert, altert nicht, ihre Übersetzung hingegen schon? Und was macht Sonnenberg anders als sein Vorgänger, zumindest da, wo ein direkter Vergleich möglich ist?
In der Suada, die ab 1899 nicht mehr im Roman steht, wendet sich der Erzähler in Manier eines Hiob an Gott, der ihn verlassen hat, und lässt ihn hören, wie sehr er ihn dafür verachtet. Zwar staffiert er seine Rede mit Bibelanspielungen aus – z. B. auf „Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich“ aus dem Evangelium nach Matthäus –, das aber nur, um Gott ins Lächerliche zu kehren und ihn auf die Sinnlosigkeit seiner teleologischen Versprechungen hinzuweisen. Seinem Elend zum Trotz meint der Erzähler allerdings, er sei Gott überlegen: Auch am Tag des Jüngsten Gerichts möchte er das Urteil des Herrn verspotten. Solche irrationalen, auch widersprüchlichen Ausfälle sind ganz typisch für Hamsuns Roman, denn der Hunger lässt seinen Protagonisten nicht nur im metaphorischen Sinn irre werden. Kein Grund also, die Beschimpfung irgendwie abzuschwächen. Sonnenberg behält in seiner Übersetzung den scharfen Ton bei: Im Himmelreich sind nur „schwachköpfige Idioten“ („raahovede Idioter“) und „fette, selige Huren“ („fede, salige Horer“) anzutreffen. Bei Sandmeier, dem nur die überarbeitete Fassung vorlag, klingen die Vorwürfe an Gott nicht halb so bissig. In der deutschen Übersetzung von 1921 kündigt der Erzähler nur an, er werde Gott verhöhnen und dessen Gnade „bespeien“.
Aber das ist nicht die einzige Passage, in der er religiöse Gefühle mit Füßen tritt: „Jeg skal sige dig et, min kære Herre Gud: du er en Noksagt! Og jeg nikker rasende, med sammenbidte Tænder op mod Skyerne: Du er Fan ta mig en Noksagt!“, heißt es in den Fassungen von 1890 und 1916, als der Erzähler wieder einmal an den Unwägbarkeiten scheitert. Ulrich Sonnenberg übersetzt das Schimpfwort „noksagt“ konsequent so: „‚Eines will ich dir sagen, mein lieber Herr Gott: Du bist ein Scheißkerl!‘ Wütend und mit zusammengebissenen Zähnen nicke ich hinauf zu den Wolken: ‚Zum Teufel noch mal, du bist ein Scheißkerl!‘“ Sandmeier hingegen scheint die grobe Sprache Probleme zu bereiten: „Eines will ich dir sagen, mein lieber Herr und Gott: du bist ein – na kurz und gut! Und ich nicke wütend mit zusammengebissenen Zähnen zu den Wolken hinauf: Du bist, der Teufel hol‘ mich, ein –“ Bei Sandmeier gehen außerdem entscheidende Nuancen verloren. Die Anrede „min kære Herre Gud“ klingt auch schon im Norwegischen schräg, Sonnenbergs übersetzt folgerichtig mit „Herr Gott“. Sandmeiers „mein lieber Herr und Gott“ ist zu schwach, denn der Erzähler akzeptiert Gott eben nicht als seinen Herrn, sondern spricht ihn an wie einen gewöhnlichen Mann von der Straße.
Auch die erotische Begegnung mit der Frau namens Ylajali hat Hamsun einer kräftigen Überarbeitung unterzogen – hier streicht er nicht nur, sondern fügt auch hinzu, so lässt es sich an einem Vergleich zwischen der Fassung von 1907 und Sandmeiers Text ablesen. Mit zunehmendem Alter scheint der Autor prüder geworden zu sein. So lautet die betreffende Passage 1890 und 1899 noch folgendermaßen:
»Forsøg at faa fat på mig!« sagde hun.
Og under megen Latter forsøgte jeg at faa fat på hende. Mens hun sprang omkring, løste hun Sløret op og tog Hatten af; hendes spillende Øjne hang fremdeles ved mig og vogted paa mine Bevægelser.
(Hamsun, 1890/1899)
«Versuchen Sie, mich zu fangen!», forderte sie mich auf. Und unter großem Gelächter versuchte ich, sie zu fangen. Während sie umhersprang, löste sie den Schleier und nahm den Hut ab; ihre lebhaften Augen hingen noch immer an mir und taxieren meine Bewegungen.
(Sonnenberg 2023)
Diese Passage wird laut Dingstad ab 1907 abgeändert in:
Saa begyndte hun at løse Sløret op og tog Hatten af; imens hang hendes spillende Øjne ved mig og vogted paa mine Bevægelser saa jeg ikke skulde faa fat i hende.
(Hamsun 1907)
Dann löste sie den Schleier und nahm den Hut ab; währenddessen hingen ihre funkelnden Augen an mir und wachten auf meine Bewegungen, damit ich sie nicht fassen könnte.
(Sandmeier 1921/2023)
Wenn Hamsun nur die Handlung wiedergibt, aber auf die Dialogzeile verzichtet, wirkt die Passage weniger unmittelbar. Aber das hindert ihn nicht daran, die Temperatur an einer anderen Stelle wieder hochzuschrauben: „Hvilken vidunderlig Nydelse!“, denkt der Erzähler in den ersten beiden Fassungen noch über Ylajali (Sonnenberg: „Welch wunderbarer Genuss!“). Ab 1907 steht da: „Hvilken vidunderlig Nydelse at sidde i en Menneskebolig igen og høre en Klokke tikke og snakke med en ung, levende Pige istedenfor med mig selv“ (Sandmeier: „Welch ein wunderbarer Genuss, wieder in einer menschlichen Wohnung sitzen und eine Uhr ticken zu hören, und anstatt mit mir selbst mit einem jungen, lebendigen Mädchen zu reden!“). Und wo den Erzähler in den Ausgaben von 1890 und 1899 jedes von Ylajalis Worten noch trifft wie „Weintropfen mitten ins Herz“, ist ab 1907 folgender Zusatz zu lesen: „skønt hun vist var en svært almindelig Kristianiapige med Jargon og smaa Kækheder og Prat“ (Sandmeier: „obwohl sie gewisslich ein höchst durchschnittliches Kristianiamädchen war, mit Jargon und kleinen Keckheiten und Geschwätz“). Wie Petersen in seinem Nachwort schreibt, führt diese Konkretisierung zu einem stilistischen Widerspruch, weil der Erzähler hier einen Kommentar zu „Ylajalis“ gesellschaftlicher Stellung abgibt und damit – obwohl er doch eigentlich der anonyme Mensch aus der Masse ist – plötzlich die Frage nach seiner eigenen Klassenzugehörigkeit aufwirft.
Dingstad zitiert noch eine weitere Passage von 1899, die 1907 verschwunden und durch einen neuen Abschnitt ersetzt worden ist:
»Ja, lad mig faa kysse Dem paa Brystet først, saa.«
»Er De gal? Saa, begynd nu!«
»Nej, kære, lad mig nu faa Lov til det først!« »Hm. Nej, ikke først .… Siden kanske … Jeg vil høre, hvad De er for et Menneske.… Aa, jeg er sikker paa, det er forfærdeligt!«
Det pinte mig ogsaa, at hun skulde tro det værste om mig, jeg var bange for at støde hende helt bort, og jeg holdt ikke ud den Mistanke, hun havde om mit Levnet. Jeg vilde rense mig i hendes Øjne, gøre mig værdig til hende, vise hende, at hun sad ved en paa det nærmeste engleren Persons Side. Herregud, jeg kunde jo tælle paa Fingerne mine Fald til Dato.
Jeg fortalte, jeg
(Hamsun 1890/1899)
«Ja, aber lassen Sie mich erst Ihre Brust küssen, dann.»
«Sind Sie verrückt? Los, fangen Sie an!»
«Nein, Liebste, erlauben Sie es mir zuerst!» «Hm. Nein, nicht zuerst … Später vielleicht … Ich will hören, was für ein Mensch Sie sind … Oh, ich bin sicher, es ist entsetzlich!»
Es quälte mich, dass sie das Schlimmste von mir glaubte, ich hatte Angst, sie ganz von mir fortzustoßen, und ertrug den Verdacht nicht, den sie hinsichtlich meiner Lebensweise hegte. Ich wollte mich in ihren Augen reinwaschen, ich wollte mich ihrer würdig erweisen, ihr zeigen, dass sie neben einer nahezu engelsreinen Person saß. Herrgott, ich konnte meine Vergehen bis heute doch an einer Hand abzählen.
Ich erzählte, ich
(Sonnenberg 2023)
Ab 1907 steht da nur noch:
Aa hvor jeg blev træt! Hvor gærne jeg heller vilde have siddet stille og set paa hende end skabe mig til og mase med all disse Forsøg. Jeg duede til intet, jeg var bleven en Klud.
Begynd nu! sa hun. Jeg greb Lejligheden og
(Hamsun 1907)
Ach wie müde ich geworden war! Wie gerne wäre ich lieber still gesessen und hätte sie angesehen, als mich hier aufzuspielen und mich mit all diesen Versuchen zu quälen. Ich taugte zu nichts, ich war ein Fetzen geworden.
Fangen Sie an!, sagte sie. Ich ergriff die Gelegenheit und
(Sandmeier 1921/2023)
Zwar sind sich der Erzähler und „Ylajali“ in der Passage von 1890 sympathisch, aber der Erzähler schämt sich für seine Armut, auch bei „Ylajali“ sieht es nicht viel besser aus – obwohl es sie nicht ganz so schlimm getroffen hat wie ihn. Auch wenn die Sache nicht gut ausgeht, ist nicht alles düster, und die Szene ist geprägt von einer erotischen Vitalität. Ganz anders in der Fassung von 1907: Der Kuss auf die Brust fehlt, der Dialog zwischen Ylajali und dem Erzähler ist gestrichen. So bleiben dem Erzähler nur noch Selbstkasteiung und Desillusion.
Diese wenigen Beispiele zeigen schon, wie sehr die Deutung – und damit auch die Übersetzung – eines Klassikers von der jeweils gewählten Vorlage abhängt. Wie ist Hunger also zu lesen? Der Text von 1890 ist unerbittlicher, etwa, wenn es um die Frage geht, wieso Gott das Leid des Erzählers zulässt, aber auch zärtlicher, denn dass sich die Figur trotz ihrer zahlreichen Probleme überhaupt auf „Ylajali“ einlassen mag, setzt eine gewisse Bereitschaft zur Verletzlichkeit voraus. Das ändert sich in den späteren Fassungen. Zum einen werden die wütenden Tiraden gegen Gott abgeschwächt, zum anderen macht die Lebhaftigkeit, die dem Erzähler aller widrigen Umstände zum Trotz zu eigen ist, einer größeren Ernüchterung Platz. Welche Version ist also die bessere? Das hängt vor allem davon ab, wie gut oder schlecht die Übersetzungen ihre jeweilige Vorlage wiedergeben.
Obwohl Marie von Borch Hunger als erste ins Deutsche gebracht hatte, lässt sich Julius Sandmeiers Einfluss auf die deutsche Rezeption von Hamsuns Debüt kaum abstreiten. „Sandmeier, ein hervorragender Übersetzer, hat jetzt … den Auftrag erhalten, Hamsuns gesammelte Werke zu übersetzen“, stand 1921 in einer Notiz der Zeitung Harstad Tidende zu lesen. Seit 1921 ist seine Fassung immer wieder erschienen, nicht nur bei Albert Langen, sondern auch bei List, Suhrkamp oder dtv.
Bei einer näheren Lektüre fällt zunächst einmal auf, wie wörtlich Sandmeier oft übersetzt. Als der Erzähler versucht, sich als Feuerwehrmann zu bewerben, wartet er mit zahlreichen Konkurrenten auf den Bescheid: „Vi stod halvhundrede Mand i Forhallen“, steht bei Hamsun. Sonnenberg schreibt: „Wir standen zu fünfzig Mann in der Vorhalle“. Und Sandmeier: „Wir standen ein halbes Hundert Mann in der Vorhalle“. Zwar ist auch schon das Norwegische schräg, aber wenn einfach so übernommen wird, was im Text steht, klingt es auch im Deutschen verkehrt. Sonnenberg entscheidet sich für die einzig nachvollziehbare Lösung, während Sandmeier sklavisch an der Vorlage kleben bleibt. Als der Erzähler sich ausdenkt, wie eine weibliche Zufallsbekanntschaft heißen soll („Ylajali“), verpasst er ihr damit „einen Namen mit einem geschmeidigen, nervösen Laut“ (Sonnenberg), der bei Sandmeier zu einem Namen mit einem „gleitenden, nervösen Laut“ wird. Zwar gibt Sandmeier Hamsuns „glidende“ lexikalisch korrekt wieder, aber Sonnenbergs Lösung ist um einiges besser, weil sie am treffendsten die taktile, geradezu erotische Qualität der Sprache transportiert, die ein wichtiges Element von Hamsuns vitalistischer Poetik ist.
Während sich der Protagonist bei Sonnenberg lediglich „einen Ruck“ gibt, „strammt“ er sich bei Sandmeier „auf“ – eine Übersetzung, durch die der norwegische Text herausdröhnt, denn bei Hamsun heißt es: „jeg strammet mig op“. Aber nicht nur das, manchmal übersetzt Sandmeier so wörtlich, dass nicht klar wird, was eigentlich gemeint ist. „Naturligvis ville jeg hilse dypt på henne“, schreibt Hamsun an einer Stelle. Sandmeier macht hieraus: „Natürlich würde ich sie tief begrüßen“ – womit, wie Sonnenberg korrekt wiedergibt, lediglich eine „tiefe Verbeugung“ gemeint ist. In einer weiteren Passage gibt sich der Erzähler beim Spazieren seinen Gedanken hin und beobachtet währenddessen andere Menschen, die, zumindest bei Sandmeier, „jung und vor kurzem erschlossen“ worden sind. Diese Stelle ergibt erst bei Sonnenberg Sinn, der Hamsuns „utsprungen“ zutreffend mit „erblüht“ übersetzt.
Ebenso ist Sandmeiers Übersetzung an vielen Stellen inkonsequent, unfreiwillig komisch oder falsch. Zeitungsnamen tauchen bei ihm mal auf Deutsch („Morgenblatt“), mal auf Norwegisch („Aftenposten“) auf, das Sonderzeichen „æ“ wird mit „ae“ wiedergegeben (z. B. die Ortsbezeichnung „Grændsen“, die Sandmeier falsch schreibt: „Graensen“). Solche Versehen hätten sich in einer Neuauflage durchaus korrigieren lassen. Wegen seiner Verwahrlosung hat der Erzähler Angst, er gelte als jemand, der „kleine Mädchen aufgabeln“ geht (Sonnenberg; Hamsun: „kapred Smaapiger“). Bei Sandmeier werden die Mädchen „gekapert“ (vielleicht hätte „entführt“ besser gepasst, „aufgabeln“ ist ein wenig zu schwach formuliert, immerhin geht es hier um ein Verbrechen). Er bezeichnet lästige Kinder, die bei Hamsun bloß „Tyvetøser“ heißen, gleich als „Dirnen“, während Sonnenberg das Schimpfwort richtig mit „kleine Rotzgören“ übersetzt – hier ist nicht von Prostituierten die Rede („tøs“ ist nicht nur ein älteres Wort für ein kleines Mädchen, sondern auch für eine Sexarbeiterin, dann aber eher in der Verbindung „Gadetøs“, „Straßenmädchen“).
Aber Sandmeiers Übersetzung macht nicht nur auf der lexikalischen, sondern auch auf der syntaktischen Ebene Probleme. „Sogar nachdem ich eine Bank gefunden und mich niedergesetzt hatte, fuhr diese Frage fort, mich zu beschäftigen und mich zu hindern, an andere Dinge zu denken“, steht bei Sandmeier im ersten Teil des Romans. Sonnenberg macht daraus: „Auch nachdem ich eine Bank gefunden und mich gesetzt hatte, beschäftigte mich diese Frage noch und hinderte mich daran, an andere Dinge zu denken.“ Ein Blick in die norwegischen Vorlagen macht klar, wieso Sonnenbergs Vorschlag gelungener ist (hier zitiert in der Fassung von 1890, der Text bleibt 1917 inhaltlich unverändert stehen): „Endog efterat jeg havde fundet mig en Bænk og sat mig ned, vedblev dette Spørgsmaal at sysselsætte mig og hindre mig fra at tænke paa andre Ting.“ Sandmeiers Infinitivkonstruktion („fuhr fort zu … und mich zu …“) liest sich zu schwerfällig, er hangelt sich mechanisch an Hamsuns Text entlang. Hier werden zwei Tätigkeiten fortgesetzt: Der Erzähler stellt sich nicht nur die gleiche Frage mehrmals hintereinander, sie hält ihn auch noch von anderen, vielleicht ertragreicheren Überlegungen ab. Sonnenberg übersetzt Hamsuns „vedblev dette Spørgsmaal at sysselsætte mig“ sehr elegant mit „beschäftigte mich diese Frage noch“ und umgeht dadurch den leidigen Infinitiv. Da er allerdings zu einem Verb mit Präposition greift (jemanden an etwas hindern), wirkt auch seine Variante etwas unbeholfen: „… beschäftigte mich diese Frage noch und hielt mich von weiteren Gedanken ab“ wäre vielleicht eine besser lesbare Lösung.
Da Knut Hamsuns Werk 2023 gemeinfrei wird, ist es keine Überraschung, dass eine alte und eine neue deutsche Fassung von Hunger in den Handel kommen, aber hieran lässt sich ablesen, wie kurz die Halbwertzeit einer Übersetzung manchmal ist. Zwar hat sich Sandmeiers Text immerhin bis zu Weibels Fassung von 2009 gehalten, aber im direkten Vergleich mit Sonnenbergs Version fällt nicht nur auf, wie veraltet er ist, sondern auch, wie groß die Unterschiede zwischen dem norwegischen Ausgangstext von 1890 und 1916 sind. Außerdem sticht heraus, wie eng sich Sandmeier an die Vorlage klammert. Insgesamt findet Sonnenberg passendere Lösungen, etwa auf der Satzebene, aber durch behutsame Archaisierungen macht er den zeitlichen Abstand zwischen Ausgangs- und Zieltext klar: Zum Beispiel übersetzt er Hamsuns „naar Lykken var god“ mit „wenn das Glück mir gewogen war“, modernisiert aber auch dort, wo es nötig ist: Der „Rausch von Inspiration …“, der bei Sandmeier noch „eines wunderbaren Himmels Tat“ am Geist des Erzählers war, wird bei Sonnenberg zur „Tat des wundervollen Himmels“. Zwar mögen Genitivinversionen für einen Text von 1921 noch gerade so in Ordnung sein, 2023 wären sie aber mehr als altbacken. Nur manchmal ist nicht nachvollziehbar, wieso Sonnenberg Gedanken des Erzählers in Anführungszeichen setzt, wo doch im Norwegischen keine stehen.
Aber das sind bloß Kleinigkeiten. Wer Hunger oder das Werk des norwegischen Literaturnobelpreisträgers überhaupt kennenlernen will, ist mit Sonnenberg bestens bedient. Anders sieht das bei Sandmeier aus. Seine Übersetzung ist völlig aus der Mode gekommen und höchstens noch für diejenigen von Belang, die sich mit Hamsuns Rezeption in Deutschland vertraut machen wollen und dafür eine Referenzausgabe benötigen. Das dürften allerdings die wenigsten sein. Darüber hinaus ist fraglich, wieso der Anaconda-Verlag eine Übersetzung neu auf den Markt bringt, die ganz leicht online zu finden und noch dazu nicht unbedingt die gelungenste ist. Sonnenberg, der an den Anfang zurückgeht und den Text in seiner ursprünglichen, wilderen Form ins Deutsche holt, dürfte der deutschsprachigen Hamsun-Rezeption einige neue Facetten hinzufügen, eine Neuauflage von Sandmeiers Fassung eher nicht.