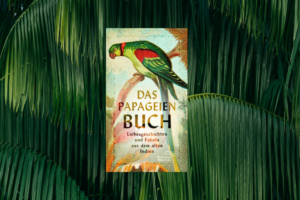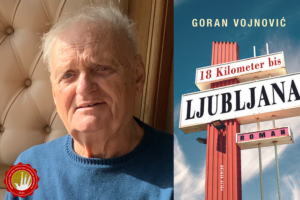Davon können Eltern auf der ganzen Welt wohl ein Lied singen: Nur selten lassen sich die lieben Kleinen abends mit einer einzigen Gutenachtgeschichte abspeisen, bevor sie Einschlafen auch nur ansatzweise wohlwollend in Erwägung ziehen. Der kleine Bär von Kitty Crowther ist da keine Ausnahme – doch immerhin formuliert er seine Erwartungen transparent und fordert ohne Umschweife gleich drei Geschichten: „Bitte, bitte und bitte. Ich habe auch dreimal bitte gesagt!“

Und so erzählt ihm seine Mutter erst die Geschichte von der Nachtwächterin, die allabendlich mit ihrem Gong den Tieren des Waldes die Stunde der Nachtruhe schlägt – aber von wem erfährt sie selbst, dass es Zeit zum Schlafen ist? Die mutige Zora verirrt sich beim Brombeersammeln im Wald und findet einen ungewöhnlichen Schlafplatz, und zum Schluss begleiten wir den kleinen Bo, der auf der Suche nach einer Mütze voll Schlaf seinen Freund, den Otter Otto, besucht.
Die belgische Autorin Kitty Crowther, 1970 als Tochter einer Schwedin und eines Briten in Brüssel geboren und 2010 für ihre Bilderbücher mit dem Astrid Lindgren Memorial Award, dem wichtigsten internationalen Preis für Kinder- und Jugendliteratur, ausgezeichnet, hat mit Petites histoires de nuits (Pastel 2017) ein wunderbares Vorlesebuch erschaffen. Und Tobias Scheffel, der unter anderem 2011 den Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises für sein Gesamtwerk als Übersetzer erhielt, hat Kleine Gutenachtgeschichten (Verlag Antje Kunstmann 2021) wunderbar ins Deutsche übertragen.
Das mag auf den ersten Blick gar nicht schwer aussehen, ist doch die Sprache des Originals denkbar schlicht gehalten. Die Kunst besteht gerade darin, diese Schlichtheit ebenso überzeugend rüberzubringen. Die Geschichten nehmen sich erzählerisch weit zurück und verzaubern durch ihren märchenhaft anmutenden Minimalismus.

Dans la forêt profonde, pas très loin d’ici, vivait une gardienne de nuit.
Nicht weit von hier, tief im Wald, lebte eine Nachtwächterin.
Scheffel hält sich eng an die Syntax der Vorlage und widersteht der Versuchung, sie im Deutschen komplexer zu gestalten. Seine Sprachfertigkeit zeigt sich an unauffälligen Details wie der Umstellung des Satzes „Nicht weit von hier, tief im Wald…“ Damit nimmt er uns erzählerisch quasi an die Hand und führt uns geradewegs in den Wald und in die Geschichte hinein.

In der einfachen Sprache wirken durch expressive Wörter gesetzte Akzente umso stärker, etwa wenn der schlaflose Bo, der im Nest „einer übellaunigen alten Eule“(„une vieille chouette mal lunée“) wohnt, nicht „das kleinste Fitzelchen Schlaf“ („une miette de sommeil“) findet. Das französische Passepartout-Wörtchen „d’accord“ übersetzt Scheffel je nach Situation treffend mit „einverstanden“ oder „schon gut, schon gut!“. Und als das Bärenjunge am Ende immer noch keine Anzeichen von Müdigkeit zeigt, sondern im Gegenteil beim Erzählen unauffällig aus dem Bett auf den Schoß seiner Mutter gekrabbelt ist und – inspiriert durch die gerade gehörten Abenteuer – voller Tatendrang neue Pläne schmiedet, sagt die Bärenmutter immer noch freundlich, aber schon einen Hauch bestimmter: „jetzt wird geschlafen“ („c’est l’heure de sombrer“).
Ein bisschen knifflig wird es bei der letzten Geschichte, die auf der logischen Kette „perdre son sommeil (– chercher son sommeil) – trouver son sommeil“ aufbaut. Dass der eigene Schlaf als eine Sache beschrieben wird, die man verloren hat und nun suchen geht, um sie wiederzufinden, ist in der Übersetzung nicht ganz so konsequent nachzubilden, denn man kann im Deutschen nun mal nicht „seinen Schlaf verlieren“. Es klingt aber zumindest an:
„[L’histoire] du monsieur avec son grand manteau qui a perdu son sommeil.“ […]
„Impossible de trouver une miette de sommeil.“ […]
„Bo sortit dans les bois chercher son sommeil.“
„Die [Geschichte] von dem Herrn mit dem großen Mantel, der keinen Schlaf fand.“ […]
„Unmöglich, auch nur das kleinste Fitzelchen Schlaf zu finden.“ […]
„Auf der Suche nach dem Schlaf ging Bo in den Wald hinaus.“
Dafür funktionieren manche Namen im Deutschen sogar noch viel besser als im Original: Aus „la loutre Otto“ kann nur „Otto, der Otter“ werden, und die kleine Zora (frz. Zhora), die nachts mutterseelenallein im Wald unterwegs ist, erinnert passenderweise an die Rote Zora, die wilde, mutige Bandenchefin aus dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Kurt Held. Glückliche Zufälle natürlich, aber auch als Übersetzer darf man ja mal Glück haben.
Anders als viele andere Kinderbücher bemüht sich dieses nicht dezidiert um Umgangssprachlichkeit, sondern bleibt sprachlich weitgehend neutral – im Deutschen sogar noch mehr als im Französischen. „Oh miam!“ wird mit „Oh, lecker!“ übersetzt (semantisch völlig richtig, aber eben einen Tick korrekter), und auch manche Ellipsen des Originals werden vervollständigt:
„Toujours tes problèmes de sommeil?“ demanda Otto.
„Oui“, soupira Bo.
„Hast du immer noch deine Schlafprobleme?“, fragte Otto.
„Ja“, antwortete Bo seufzend.
Das hätte man zwar auch auf Deutsch noch knapper formulieren können, doch insgesamt fügt sich der Erzählstil wunderbar in den Tonfall der Geschichten ein, die gelassen und entschleunigt daherkommen und unterhaltsam, aber eben nicht zu aufregend sind … perfekt zum Einschlafen!