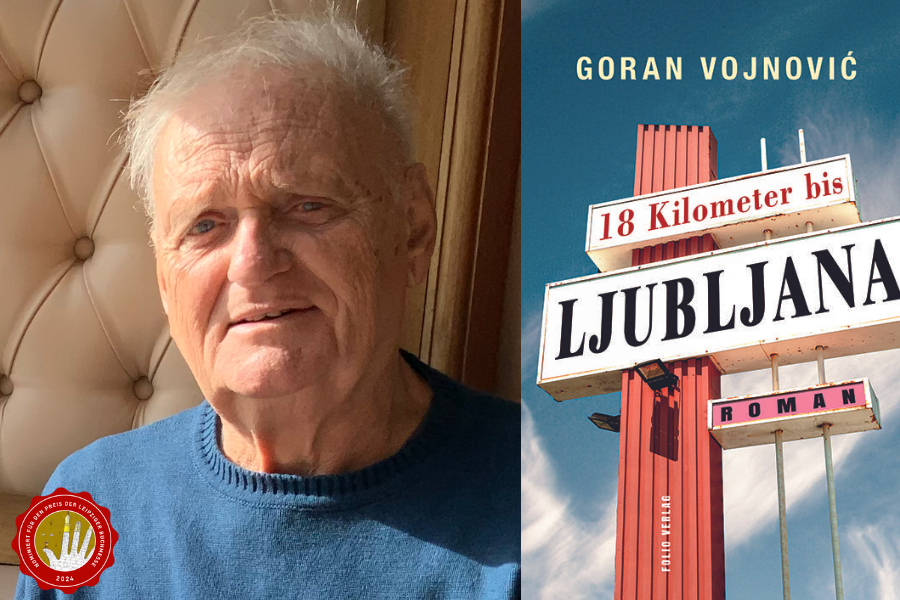Übersetzung: Tobias Eberhard.
Der Text erschien in dem Magazin The Paris Review.
Das Übersetzen ist ein seltsames Handwerk. Man muss die Stimme einer Autorin, eines Autors einfangen und von einer Sprache in eine andere bringen, dabei jedoch so gut wie keine Hinweise darauf hinterlassen, dass dieses Hinüberbringen jemals stattgefunden hat. (Die Ausnahmeübersetzerin Charlotte Mandell bezeichnet diese Umwandlung als „das Gleiche, aber anders.“) Auch wenn einem lästige Schreibblockaden erspart bleiben, so sieht man sich als Übersetzer*in doch auch der leeren Seite gegenüber, die gefüllt werden möchte. Dabei besteht die Gefahr, dass man so tief in den Ausgangstext eintaucht, sich so strikt an der Ausgangssprache entlanghangelt, dass der Text in der Zielsprache gekünstelt wirkt, sich ungelenk liest oder, noch schlimmer, unlesbar wird. Und doch ist dieses Eintauchen unvermeidlich, ja sogar erforderlich.
Vergleichbar mit einem Ghostwriter muss die übersetzende Person in eine andere Haut schlüpfen. Manchmal geht dieser Übergang sanft vonstatten, unauffällig, ohne Gegenwehr. Doch manchmal geschieht dieses Ankommen plötzlich, laut und sogar auf unangenehme Weise. Bestimmte Strategien, die über die bloßen Handgriffe des Übersetzens hinausgehen, erleichtern mir persönlich das Eintauchen: das Auffindbarmachen von Referenzen, um die kulturellen Bezugspunkte (Bücher, Filme, Musik) der Autorin, des Autors zu rekonstruieren; das laute Vorlesen von Abschnitten, erst im Original, dann in meiner Übersetzung, bis ich heiser werde; den Text mit meinen Fingern, meiner Nase, meinen Augen, meinen Ohren spüren, um die Handlung über meine Sinne zum Leben zu erwecken; das Aufsaugen jedes Hinweises, der mir dabei hilft, meine Übersetzung mit der gesamten Bandbreite der Autor*innenstimme (Humor, Wut, Trauer, Distanziertheit) sprechen zu lassen.
Der erste literarische Text, den ich übersetzt habe, – France, Story of a Childhood – war mein Einstieg in das, was ich als immersives Übersetzen bezeichne. In diesem autobiografischen Roman erzählt die in Algerien geborene Autorin Zahia Rahmani von ihrer turbulenten Kindheit im ländlichen Frankreich der 1960er Jahre. Die Erzählung wird immer wieder von Episoden unterbrochen, in denen die Autorin ins Jahr 2005 springt. Zu dieser Zeit liegt ihre Mutter im Sterben, und Paris und andere französische Städte versinken in Aufständen, die sich aufgrund des vorherrschenden Rassismus bahnbrechen. Der Ton des Buchs ist mal wütend und traurig, mal poetisch und explosiv. Als ich France zum ersten Mal las, lebte ich ebendort, in Frankreich. Ich war allein, weit weg von zuhause, und je länger ich dort war, desto bewusster wurden mir die Sterblichkeit meiner Eltern und die Grenzen von Zeit und Ort. Die Berichte der Mutter der Autorin über Algerien lösten in mir Heimweh nach Tunesien, meinem nordafrikanischen Heimatland, aus, das auch ich jung verlassen hatte.
Ich verbrachte Stunden mit den technischen Aspekten der Übersetzung, bildete Rahmanis nahtlose Übergänge zwischen Zeitformen nach, arbeitete die Unterschiede zwischen Dialog und innerem Monolog heraus und gebot der präpositionalen Verwirrung, die sich oft beim Übersetzen vom Französischen ins Englische ergibt, Einhalt. Aber ich wollte noch tiefer eintauchen. Genau wie Pierre Menard, Borges‘ übereifriger Übersetzer, war ich davon überzeugt, dass ich eine literarische Symbiose erschaffen könnte, wenn ich nur weit genug vordrang. Ich hörte mir eine „Zahia“-Playlist mit den Doors und Patti Smith auf Spotify an, da diese Künstler*innen für sie als Jugendliche eine wichtige Rolle gespielt hatten. Ich las sämtliche Bücher, die in France erwähnt wurden. Teile des Romans sind in Kabylisch verfasst, einem von der Mutter der Erzählerin gesprochenen Berberdialekt, also hörte ich mir Audioclips der Sprache an und zog Sprachexpert*innen zu Rate. Ich sagte mir den Text ein Dutzend Mal auf, um sicherzugehen, dass der Klang meiner Übersetzung dem des Originals gleichkam.

Ich traf Rahmani ein Jahr nachdem ich mit der Übersetzung ihres Buches begonnen hatte. Da stand mir eine Autorin gegenüber – eine imposante, bühnenhafte Frau in einem schwarzen Kaftan – deren intimsten Momente ich nicht nur gelesen, sondern regelrecht studiert hatte. Ein versuchter Suizid, die erste Liebe und Lust, Trauer über den Tod eines Elternteils. Ich hatte ihre Sprache mitsamt allen Emotionen aufgesogen, mit einer solchen Hingabe und Intensität, dass es mich beunruhigte, sie vor mir stehen zu sehen. Ich hörte ihr zu und sagte nicht viel.
Vor Kurzem habe ich dann einen Roman übersetzt, der in Marokko spielt. The Hospital (auf Deutsch Das Krankenhaus, übersetzt von Michael Kleeberg), im Jahr 1989 vom mittlerweile verstorbenen Autor und Filmemacher Ahmed Bouanani geschrieben, spielt in einem Krankenhaus, in dem die Patient*innen inmitten von Wahnsinn, Resignation und Chaos vor sich hin siechen. Sein Zwangsaufenthalt in einem Sanatorium für Tuberkulosekranke diente Bouanani als Inspiration für dieses Buch. Als der Erzähler einen Fuß über die Schwelle des Krankenhauses setzt, verschwindet der Eingang, und der Erzähler verliert jegliches Gefühl für Raum und Zeit: „Die Luft hier begünstigt das Wachstum seltsamer Pilze in der Imagination. Zu jeder Stunde bin ich gefangen zwischen Schwindel und Fieberwahn.“
Bouananis Stimme hatte mich sofort gefangen genommen – harsch, zuweilen krass. Doch schienen stets Nostalgie und Traurigkeit durch seine Respektlosigkeit hindurch. Auch wenn seine Art zu schreiben direkter ist als Rahmanis (keine wechselnden Zeitformen oder gegeneinanderlaufenden Erzählstränge, die es aufzulösen gilt), war es schwieriger seine Stimme anzunehmen. Ich musste neue sprachliche Hürden überwinden: Bouanani hatte die Vorliebe, Redewendungen aus Darija, einem marokkanischen Dialekt, in die französische Standardsprache einfließen zu lassen. Als ich mit meiner Übersetzung zur Hälfte fertig war – voller Verbitterung über meinen Vollzeitjob, der mich von meinem Handwerk abhielt, und frustriert darüber, dass ich keinen Verlag für dieses verrückte kleine Juwel fand – verlor ich den Faden. Die Verbindung war abgerissen.
Wie konnte ich wieder in Bouananis Universum eintauchen? Ich begann mit einfachen Dingen. Das Alpenveilchen: Wie genau sieht diese Blume aus? Wie riecht sie? Die falschen Erinnerungen des Erzählers erschwerten meine Aufgabe – seine Version des Alpenveilchens basiert auf „imaginierten Erinnerungen an etwas, das einer Efeupflanze oder einer Mohnblume oder vielleicht auch einem Rhododendron ähnelt“. Ich konnte Bouananis literarische Einflüsse heraufbeschwören, Borges, Buzzati, Cendrars, doch seine Filmographie war für mich schwerer zugänglich. Und dann – ironischerweise, in Anbetracht des Subtextes von The Hospital – wurde ich krank. Ich litt an einer Vielzahl von Symptomen, ausgelöst von einer Erkrankung, die erst nach Monaten diagnostiziert wurde und deren Heilung noch länger dauerte: Ich litt an Schwindelanfällen.
Ebenso wie der anonyme Erzähler von Das Krankenhaus schwankte ich zuweilen „wie ein betrunkenes Boot“, irrte umher, während die Grenzen zwischen oben und unten, links und rechts vor meinen Augen verschwammen. Mir war ständig schwindelig, egal ob ich saß oder stand, oft fiel ich sogar hin. Manchmal wurde der Schwindel so schlimm, dass ich mich eine Minute lang, oder fünf, oder dreißig, in meinem Arbeitszimmer auf den Boden legte. Flach auf dem Rücken liegend dachte ich an Bouananis Erzähler, vor Schwindel und Wahn an sein Krankenhausbett gefesselt, während in seinem Hirn die Pilze sprossen; wie er über dem Bett schwebt und auf seinen Körper hinabblickt. Als ich schließlich nicht mehr ohne Unterstützung laufen konnte, begab ich mich ins Krankenhaus.
Wobei zwischen meinem und Bouananis Krankenhaus natürlich Welten lagen. Meines verfügte zum Beispiel über eindeutig gekennzeichnete Ausgänge. Ich war freiwillig hier und konnte das Krankenhaus jederzeit wieder verlassen. Doch inmitten der unablässigen Krankenhausgeräusche, der Langeweile und Angst, mit der bohrenden Infusion in meinem Arm, musste ich unwillkürlich an Bouanani denken, eingesperrt in der mysteriösen Einrichtung, in der er die „mörderische Krankenhausluft“ atmete, während er an seinen nicht diagnostizierten Krankheiten und unter der unzureichenden Pflege vor sich hin litt.
Ich hatte mehr Glück als die Patient*innen in Bouananis Krankenhaus: Mein Aufenthalt war kurz und meine Genesung unkompliziert. Mir ging es schnell wieder besser, also beendete ich meine Übersetzung und fand mit New Directions einen Verlag, der Interesse daran hatte. Meine monatelange körperliche Verschlechterung war unerwartet und unerwünscht, doch hat mich diese Erfahrung einem Autor nähergebracht, der hinsichtlich seines Alters, seines Geschlechts, seiner Lebenssituation und seiner Zeit so weit von mir entfernt gewesen ist. Die schiere Körperlichkeit dieser Erfahrung – ein zwanghaftes Bewusstsein, welche Position ich innerhalb des Raumes einnahm – lenkte mich von den linguistischen Sorgenkindern (wie etwa Sprache, Satzbau, Wortwahl) ab, die eine gute Übersetzung einerseits ausmachen, ihr andererseits aber auch im Wege stehen können. Stattdessen existierte ich an Bouananis Seite, wobei meine eigenen lebhaften Empfindungen die Art und Weise beeinflussten, wie ich seine Worte übersetzte. Ich frage mich, wie ich meine Übersetzung in fünf oder zehn Jahren empfinden werde. Wird meine eigene Erfahrung durchscheinen? Habe ich, trotz meiner akribischen Überarbeitung, einen Teil von mir selbst auf den Seiten hinterlassen? (Und wenn dem so ist, wäre das wirklich so schlimm?)
Und noch mal: Das Übersetzen ist ein seltsames Handwerk. Die übersetzende Person ist zugleich überall sichtbar und unsichtbar. Die übersetzende Person greift auf das Leben und die Erinnerungen einer Figur, egal ob fiktional oder real, zu – ein allumfassender Akt, um die in einer Sprache heraufbeschworenen Empfindungen in einer anderen nachzubilden. Stundenlanges Lesen, Recherchieren, Analysieren und Übersetzen können dafür sorgen, dass eine tröstliche und zugleich trügerische Verbindung entsteht. Hin und wieder kommt mir plötzlich ein Wort oder ein Satz aus den Büchern von Rahmani oder Bouanani in den Sinn. Ich brauche einen Moment, um sie zuzuordnen und gedanklich beiseite zu legen, weil es nicht meine eigenen sind.
Ich übersetze gerade wieder einen Roman, der sich in der Welt der Medizin bewegt. Er handelt von einer jungen Frau, die an einer mysteriösen Krankheit leidet, durch die sie unerträgliche Schmerzen erfährt, immer wenn etwas oder jemand ihre Arme berührt. Das Buch dreht sich um ihre Suche nach einer Diagnose und der entsprechenden Heilung. Hoffentlich gestaltet sich das Übersetzen trotz Eintauchen in den Text für mich dieses Mal etwas sanfter.