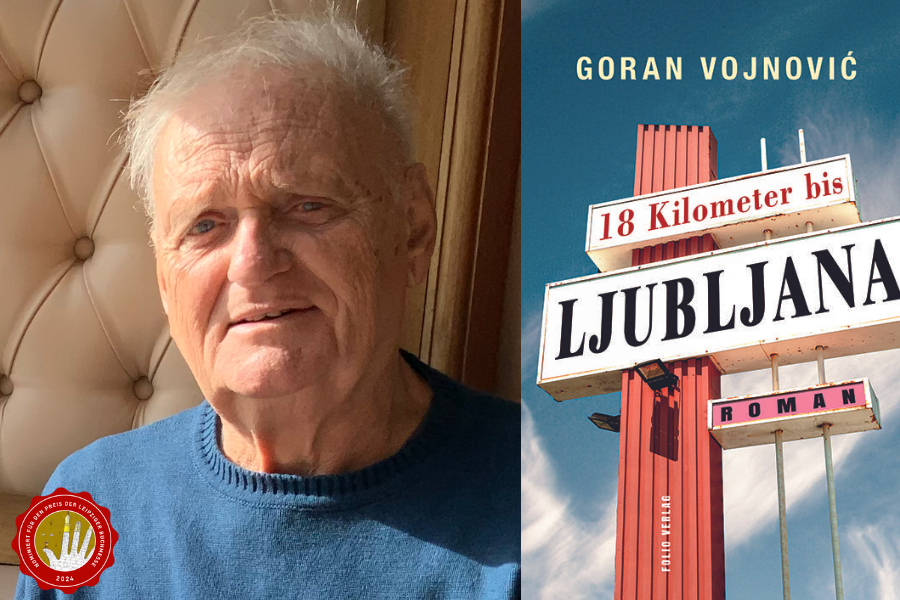Laut James Joyce nehmen die Zeit, der Fluss und der Berg in Finnegans Wake eine tragende Rolle ein, aber der Roman ist auch ein Buch der Nacht. Er nimmt uns mit ins Reich der Träume, wo wir einen geheimnisvollen Protagonisten namens HCE treffen, ein Akronym für Humphrey Chimpden Earwicker, Here Comes Everybody, Haveth Children Everywhere und viele andere. Er ist mit Anna Livia Plurabelle (ALP) verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder, den Schreiberling Shem, den Postmann Shaun sowie Isobel (Issy), und besitzen einen Pub in einem Stadtteil Dublins. Während HCE fast in eins mit Irlands grünen Hügelkämmen geht, ein bisschen wie die irische Sagengestalt Finn MacCool, ist ALP der Fluss, der ihn umfließt; und der Postmann Shaun vermittelt die Texte, die der Schreiberling Shem verfasst. Die gesamte Romanhandlung verteilt sich über eine einzige Nacht: Der Familienvater HCE liegt träumend im Bett; er ist ein reuiger Sünder, der (vielleicht) seine eigene Tochter begehrt. Er drückt sich (un)geschickt aus, will (nicht) erzählen, was los war oder ist.
Doch trotz dieses „Plots“ ist es fast unmöglich, einen roten Faden zu finden: Finnegans Wake, erstmals 1939 veröffentlicht, lässt sich überhaupt nicht als klassischer Familienroman fassen. Wie Klaus Reichert in seiner Einleitung zu einer Suhrkamp-Anthologie mit übersetzten Auszügen herausstellt, ist er etwas völlig Neues, nahezu Unbekanntes, eine „Hohlform“ dessen, was wir für gewöhnlich als Familienroman identifizieren: das naturalistische Modell, mit Émile Zola als prominentestem Vertreter. Finnegans Wake springt mal hier‑, mal dahin, die Figuren suppen ineinander, Worte werden unverständlich, unterwegs tauchen halbverzerrte Zitate auf. Joyces Text lässt sich also eher als eine Art Materialsammlung zu Archetypen mit Familienbezug beschreiben, die außerdem zu einem irisch geprägten Kulturraum gehören. Aber hier herrscht nicht nur das blanke Chaos, Joyce hat nämlich eine ganz konkrete Frage: Wie hat sich die Menschheit entwickelt? Das ist sein (unmögliches) Projekt. Und wie die Antwort darauf aussehen könnte, deutet der italienische Philosoph Giambattista Vico mit dem zyklischen Geschichtsmodell an, das er in seiner Scienza Nuova darlegt: Auf einer individuellen Ebene wiederholt jeder Mensch die Entwicklungsstadien der Kultur. Die Kultur steigt auf, entfaltet sich, steigt wieder ab. Dann beginnt alles von vorne. Der Mensch findet Trost in den vorhersehbaren Gefügen der Religion, besiegelt seine gesellschaftliche Zukunft durch die Eheschließung, und wenn er stirbt, wird er auf eine Weise bestattet, die sich von Kultur zu Kultur unterscheidet.
Passenderweise beginnt auch Joyces Roman mit einer Beerdigung. Tim Finnegan, ein betrunkener Maurer, bekannt aus einer irischen Ballade namens „Finnegan’s Wake“ (mit Apostroph), fällt von einer Leiter und ist tot. Beim Leichenschmaus wird mehr als genug Alkohol gereicht, und da erhebt sich der Mann wieder. Das ist natürlich ein christliches Motiv – Jesu Wiederauferstehung –, aber Joyce lässt den Glauben nicht für sich alleine stehen, sondern verknüpft alles, was er über seine katholische Herkunftsgesellschaft weiß, mit Vicos Philosophie. Er beschreibt das irische Volk, die „Finnegans“, als Kollektiv, das von der Geschichte und von der Religion niedergedrückt wird – deshalb steht der Romantitel auch ohne Apostroph. Spirituelle Rituale, Ehe, Beisetzungen – all das geschieht wieder und wieder, wird in einem ewigen Kreislauf, den Vico als „ricorso“ bezeichnet, immer neu ausgehandelt. Für Tim Finnegan hat das eine gewisse Situationskomik zur Folge: Ein sturzbesoffener Mann liegt mausetot auf dem Bett, aber durch gewisse Umstände wird er mit Branntwein benetzt, was ihn aufweckt und unter den Lebenden wüten lässt.
Der Fall – heißt: der Tod, aber auch der moralische Fehltritt, der den Menschen ins Straucheln bringt – ist das Leitmotiv in Finnegans Wake, einem Text, der in sich selbst genauso außer Rand und Band gerät wie ein irischer Leichenschmaus. Seine Sprache ist ja auch eben das: ein großes Vergnügen – das Buch ist auf Englisch oder, wie Reichert es in seiner Einleitung zitiert, in einer polyphonen „nat language“ verfasst, die dem Englischen nur (bedingt) ähnelt. Hier strömen viele verschiedene Sprachen ineinander und bilden einen „riverrun“. „Nat“ ist dänisch für „Nacht“, ist aber auch homophon mit „nut“, was sowohl „Nuss“ als auch „bekloppt“ bedeuten kann. Die Nacht- und Nusssprache ist so katholisch im Kopf wie atmosphärisch dicht. Finnegans Wake ist auch wegen seiner Vielstimmigkeit für viele so schwer zu lesen, aber oft gibt es Aha-Erlebnisse – oder, mit Joyce gesprochen, Epiphanien. Hier können wir uns ins Material eingraben: Erdschicht für Erdschicht mit merkwürdigen Wortbildungen. Und obwohl wir nicht immer verstehen, was wir da im Schutt aufstöbern, stoßen wir ab und an auf Altbekanntes: aus dem Englischen – oder sogar aus unserer eigenen Muttersprache.

Vico hat gesagt, jedes Wort erzähle eine kleine Geschichte, und das hat für Joyces Text gravierende Konsequenzen. In den Augen des Dichters speichern Worte Bedeutungen, sie lassen sich mit unzähligen Sinnschichten auffüllen. Wir, die ihn lesen, müssen die Bestandteile entschlüsseln. Joyce lässt sich von ungefähr sechzig Sprachen anregen, weshalb wir so viele Lexika brauchen wie nur irgend möglich. Dabei müssen wir jedoch im Hinterkopf behalten, dass Joyce nicht nur zufällige Wörter miteinander in Verbindung setzt, sondern sie in einer Kammer platziert, die so bis obenhin mit obskuren Zitaten und Andeutungen gefüllt wird. Alles wird mit dem verdrehten Blick der Nacht betrachtet – und was da im Dunkeln vor sich geht, kann man unmöglich überblicken. Die Fantasie der Leser:innen wird herausgefordert. Der Text entwickelt sich zu so etwas wie einem prototypischen Adventure Game, das seinem Publikum die Möglichkeit einräumt, auf jedem beliebigen Level zu starten.
Wer so eine Prosa übersetzt, vermag nur schwer Schritt zu halten mit denen, die potenziell alles in sie hineinlesen können, und muss sich entscheiden: Soll ich versuchen, meine eigene Lesart des Textes wiederzugeben? Oder soll ich mich an einer Nachahmung von Joyces „nat language“ probieren – d. h., Deutsch, Französisch, Niederländisch oder was auch immer meine Muttersprache ist, als Grundlage heranziehen und sie so verfremden, dass sie viele andere Sprachen beherbergen kann? Die meisten würden wohl den zweiten Vorschlag bevorzugen, weil eine Interlinearversion schnell zu sperrig wird, besonders bei so einem eigensinnigen Text wie Finnegans Wake.
Auch wenn man sich gerne erzählt, dieser Roman sei gar nicht zu übersetzen, gibt es satte sechzehn Übersetzungen auf insgesamt dreizehn Sprachen: Französisch (Lavergne 1982; Michel 2004), Deutsch (Stündel 1993), Japanisch (Yanase 1993; Hamada 2012), Holländisch (Bindervoet und Henkes 2002), Koreanisch (Kim 2002), Portugiesisch (Schüler 2003), Polnisch (Bartnicki 2012), Griechisch (Anevlavis 2013), Spanisch (Zabaloy 2016), Türkisch (Sevimay 2016), Italienisch (Mazza 2018; Schenoni, Terrinoni und Pedone 2019), Pseudolateinisch (Roberts 2019) und Serbisch (Stojaković 2020). Darauf weist Patrick O’Neill in seiner Studie Tales Of Translation hin. Ebenso gibt es über dreißig Teilübersetzungen, darunter Sprachen wie Irisch oder Altägyptisch. Außerdem, schreibt O’Neill, seien dreizehn vollständige Übersetzungen in Arbeit. Eine davon ist Leif Høghaugs norwegische.
Norwegisch ist aus vielerlei Gründen eine vortreffliche Sprache für solch ein Projekt. Es gibt zwei offizielle Varianten: das auf dem Dänischen basierte Bokmål, und Nynorsk, eine Schriftsprache, die der Sprachforscher und Dichter Ivar Aasen aus norwegischen Dialekten schuf. Zudem gibt es hunderte Mundarten. Damit kann das Norwegische über einen gigantischen Wortschatz verfügen – was einer Übersetzung von Finnegans Wake eine gute materielle Ausgangslage gibt. Aber auch Joyce selbst liefert Argumente, weshalb eine Übersetzung dieses Romans ins Norwegische lohnenswert sein könnte. Bevor Joyce Henrik Ibsen kannte, war er ein Ire, danach ein Europäer, so formuliert es Richard Ellmann in seiner Biographie des Autors. Als die Zeitschrift The Fortnightly Review Joyces’ Besprechung von Ibsens Wenn wir Toten erwachen veröffentlichte, ein Stück, das er in William Archers englischer Fassung gelesen hatte, erhielt Joyce einen Dankesbrief vom norwegischen Dramatiker selbst und fasste den Entschluss, moderne Sprachen zu studieren – zunächst Französisch und Italienisch; in der Folge aber auch Dänisch-Norwegisch. Ibsen war ein Vorbild, weil er – wie Joyce – einem kleinen Volk entstammte und im Exil gelebt hatte; Joyce verknüpfte seine eigene irische Geschichte mit der norwegisch-dänischen.
Deshalb verwundert es nicht, dass es in Finnegans Wake vor Norwegenbezügen nur so wimmelt, nicht zuletzt in der bekannten „Bygmester Finnegan“-Passage im ersten Kapitel: Das ist eine Anspielung auf den Baumeister Solness, ein Drama, das Parallelen zur Geschichte über den Maurer Tim Finnegan in der irischen Ballade aufweist. Solness, der Protagonist, hat bei einem Richtfest für einen von ihm erbauten Kirchturm die zwölfjährige Hilde kennengelernt und ihr ein Königreich versprochen. Jetzt, zwölf Jahre später, sucht sie ihn auf, um dieses Versprechen einzufordern. Solness, der an Höhenangst leidet, steigt auf den Kirchturm und stürzt in die Tiefe. Das Stück ist eine weitere Erzählung über einen moralischen Fehltritt, der tödliche Konsequenzen hat. Aber Joyce fügt dem „Bygmester Finnegan“ noch ein paar weitere Bedeutungsebenen hinzu. Bei ihm bezieht sich der „Bygmester“ sich nicht nur auf Ibsens Solness, sondern auch auf den „bugmaster“ – d.h., den Romanprotagonisten Humphrey Chimpden Earwicker und den „bug“, das „insect“ (das sich auch als „incest“ falschlesen lässt, eine Andeutung von HCEs Verbrechen). Bei Joyce verschränken sich Zweideutigkeiten und Wortwitze oft miteinander.
All das erschwert naturgemäß die Arbeit des Übersetzers. Aber Leif Høghaug ist mit Herausforderungen nicht unvertraut. Er hat das Kommunistische Manifest und Julian Talamantez Brolaskis schwer übertragbaren Gedichtband Advice For Lovers ins Norwegische gebracht, ebenso hat er 2019 einen Roman im Hadeländer Dialekt veröffentlicht (Der Kälberich; Ü.: Matthias Friedrich). Als er 2016 die Gelegenheit erhielt, einen Auszug aus seinem derzeitigen Übersetzungsprojekt in der Zeitschrift Vinduet zu publizieren, schrieb er in seinem Vorwort: „Eine alles andere als leichte Aufgabe, aber nicht unmöglich … Ich arbeite gerade an der Übersetzung und kann nun mitteilen, dass sie veröffentlicht wird, irgendwann: als norwegischer Finnegans Wake. Nynorsk, vermischt mit Hadeländer Dialekt und vielen anderen Mundarten – und Sprachen.“
Das „irgendwann“ ist hierbei der Knackpunkt. Als der Samlaget-Verlag 2016 eine Pressemitteilung herausgab, peilte man eine Veröffentlichung für 2020 an. Daraus wurde nichts, und mittlerweile sagt Høghaug selbst, er rechne erst 2030 mit dem Erscheinen des Textes. Das nicht nur, weil die Arbeit so vertrackt ist, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen: „… es liegt am verdammten Geld!“, sagte Høghaug unlängst in einem Interview mit dem staatlichen Rundfunksender NRK. „Hätte ich nur die Möglichkeit bekommen, zwei Jahre in Vollzeit daran zu arbeiten! Die Landbezirksverwaltung in Oppland hat mir für diese Arbeit ein Stipendium von 200.000 Kronen gewährt, was natürlich irre toll ist. Aber wie weit kommt man damit? Ist das ein halber Jahreslohn?“ Trotz dieser Probleme hat er bislang rund 250 von insgesamt 625 Seiten übersetzt, und dieses Jahr, zum 100. Jubiläum der Veröffentlichung von Ulysses, kam mit Finnegans Wake: fyrste bok, fyrste kapittel eine Art Singleauskopplung. Sie wurde am 16. Juni veröffentlicht, dem Bloomsday – jenem Tag, an dem Ulysses spielt. Das ist ein Grund zum Feiern – und für ein Gespräch mit Leif Høghaug über die Arbeit an seiner Übersetzung.
Herr Høghaug, in einem Interview mit dem Onlineportal BOK365 erwähnen Sie, die Idee für Ihren Roman Der Kälberich sei Ihnen bei der Übersetzung des Kapitels über Shem den Schreiberling aus Finnegans Wake gekommen. Inwieweit hat James Joyce Ihr eigenes Schreiben beeinflusst?
Ich war gerade erst fünfzehn Jahre alt geworden, da las ich Joyce zum ersten Mal. In der umfangreichen Bibliothek meiner Eltern fand ich Westlich des Monds: 56 fantastische Geschichten aus der ganzen Welt [Vestenfor måne: 56 fantastiske fortellinger fra hele verden], eine Anthologie, die 1972, zwei Jahre vor meiner Geburt, von den beiden Science-Fiction-Autoren Jon Bing und Tor Åge Bringsværd bei Den Norske Bokklubben veröffentlicht worden war, und darin stieß ich auf einen kurzen Auszug aus Ulysses in der Übersetzung der Herausgeber. Ich las. Und die Lektüre machte etwas mit mir. Definitiv. Nur was? Wie kann ich jetzt, fast 35 Jahre später, behaupten, dass ich weiß, was genau dieses „Etwas“ war? Meine Erinnerung gibt mir mehrere Versionen dieses für mich entscheidenden Ereignisses zur Auswahl, und in der Version, die ich hier und jetzt am klarsten vor Augen habe, stand ein wichtiger Entschluss bereits fest: „Ich will Schriftsteller werden.“ Das hatte der Fünfzehnjährige sich selbst gesagt. Eben aus diesem Grund hielt er sich in der elterlichen Bibliothek auf und suchte nach sogenannter relevanter Literatur.
Die Literatur – ehemals eine Traumwelt, in der er sich mit den Protagonisten identifizieren konnte (Ivanhoe, Robin Hood, Davy Crockett, Tarzan usw.) – hatte sich binnen kurzer Zeit in ein merkwürdiges, prachtvolles Textuniversum verwandelt, ja, in eine „Schreibwerkstatt“ mit gigantischen Ausmaßen. Und hier umkreisten die Fragen die Schriftstellerplaneten, Fragen, die vermutlich allesamt aus ein- und derselben Frage hervorgegangen waren, aus der großen Frage, der Frage, die – sollte man meinen – die Bewohner jedes einzelnen Planeten auf ihre je eigene Weise beantworteten: Wie schreiben? Das Portal in dieses Textuniversum hatte sich ihm bei der Lektüre von Knut Hamsuns Segen der Erde aufgetan. Und an dieser Stelle habe ich keinerlei Zweifel, dass die Erinnerung zutrifft – in dem alten, abgegriffenen Band war ich auf Seite 12 angelangt, und folgender Satz ließ mich aus den Latschen kippen: „Nachts war er gierig nach ihr und bekam sie.“ (Ü.: Alken Bruns) Was für ein Satz! Ja, was für ein Satz! Ich las den Satz als Satz. Direkt auf den Punkt und ohne Komma. Vom manifestierten Wunsch hin zur Erfüllung des Wunsches. Eine nächtliche Ereigniskette von A bis Z. In ein- und demselben kurzen Satz.
Und der Beschluss wurde gefasst: „Ich will Schriftsteller werden.“ An Ort und Stelle. Auf Seite 12 im Segen der Erde. Das Portal, über das die Erinnerung in der Zukunft sprach; jetzt hatte es sich aufgetan – und aus der Distanz, mit dem Fernrohr, bewunderte ich Hamsuns Sätze. Denn so fühlte es sich wohl an. Dass die Distanz enorm war. Die Distanz zwischen diesen göttlichen Sätzen und Klein-Leif. Aber so oder so: Der Beschluss stand fest, und als ich den Segen der Erde ausgelesen hatte, richtete ich das Fernrohr auf andere Planeten, und dann … die umfassende elterliche Bibliothek … die Anthologie … der Fünfzehnjährige liest Joyce in Bings und Bringsværds Übersetzung. „Unser kleines Detail“, schreibt das SF-Duo im Einleitungstext, „stammt aus der stimmungsvollen Beschreibung von Kiernans Pub und ist übersetzt nach der Penguin-Ausgabe von 1968, S. 294 f. Die Skizze ist lesbar als Parodie auf den Chauvinismus, und die hervorstechende Ähnlichkeit mit modernen Pop-Lyrics ist doch ziemlich kurios.“ Der Auszug, „unser kleines Detail“, besteht aus zwei Absätzen. Der erste davon lautet:
Sätze. Sätze von einem anderen Planeten. Sätze, die das Bild eines sonderbaren Körpers heraufbeschwören. Erinnerungen flüstern mir ins Ohr: „Hier hast du’s. Die Erklärung, weshalb du fast 35 Jahre lang regelmäßig das Fernrohr auf den Planeten Joyce gerichtet hast. Die Bilder dieser sonderbaren Körper. Ist Der Kälberich nicht auch ein Versuch, solche Bilder heraufzubeschwören? Sonderbare Körper, heraufbeschworen durch dialektale und ‚ungrammatische‘ Sätze à la Hadeland?“ Finnegans Wake, das Kapitel über Shem den Schreiberling. Ich zitiere erst aus dem Originaltext, dann aus meiner eigenen (in Arbeit befindlichen) Übersetzung:
Und hier noch ein Auszug aus dem Kälberich, den meine Erinnerung zitieren möchte:
Wenn ich hiermit also die Frage beantwortet habe, welchen Einfluss Joyce auf mein eigenes Schreiben ausgeübt hat … Wie auch immer, ich hoffe, diese Angelegenheit zumindest ein bisschen geklärt zu haben. – Und vielleicht wird das Ganze klarer, wenn ich hinzufüge, dass Humor und Perspektive wichtige Stichworte sind. Joyce ist ein großer Humorist, ein Galgenhumorist, und er ist der Meister der Perspektivverschiebungen. Ich will nicht angeben, aber in einem humorvollen Moment wie diesem erlaube ich mir, aus Hadle Oftedal Andersens Kritik zu Kommunion 2017 zu zitieren, meinem zweiten Gedichtband: „Die Lektüre von Leif Høghaugs Kommunion 2017 ist wie die Lektüre von James Joyces Ulysses. Man tritt ein in ein labyrinthisches Werk, in dem ständig die Perspektive bricht.“
Wann und unter welchen Umständen haben Sie zum ersten Mal von Finnegans Wake gehört?
Nachdem ich den übersetzten Auszug aus Ulysses in Bings & Bringsværds Anthologie gelesen hatte, eignete ich mir nach und nach mehr Wissen über diesen Schriftsteller namens Joyce an. Bing & Bringsværd hatten ihn als einen der „Ecksteine der modernen Literatur“ vorgestellt, als den „Schöpfer der Form, die ‚stream of consciousness heißt‘, und jetzt wollte ich mehr wissen. Zuhause in der elterlichen Bibliothek schlug ich den elften Band der Literaturgeschichte der Welt (Edvard Beyer et al., 1974) auf. Im Kompendium (Gyldendals großes Konversationslexikon, zweite Ausgabe, 1965), das ich jetzt wieder aufgeschlagen vor mir liegen habe, steht, Finnegans Wake (oder: Finnegan’s Wake; das Lexikon schreibt den Titel falsch) handele „von einer einzigen Nacht“ und sei „die Geschichte eines Traums, aber ohne die realistische Erzählung, die das Fundament des Ulysses ausmacht. Finnegan’s Wake [sic] ist ein über alle Maßen dunkles Werk, verfasst in einer Sprache, deren Anspielungsreichtum und symbolische Untertöne selbst die beflissensten Joyce-Bewunderer außen vor gelassen haben.“ Nun ja, „ein überaus dunkles Werk“. Nun ja, nun ja. Hier läuft man Gefahr, außen vor gelassen zu werden. So beflissen kann man nie sein, und trotzdem … Nein, meine erste substanzielle Einführung in Finnegans Wake hat mir vermutlich die Literaturgeschichte der Welt vermittelt. Das Kapitel brachte ein Zitat aus dem Buch – und wenig überraschend eines, das etwas über den Einfluss norwegischer Literatur auf den Iren James Joyce aussagte, mit Ibsen an vorderster Front:
Ich weiß es noch ganz genau. Wie ich zum ersten Mal diesen kurzen Auszug las. Wieder „zum ersten Mal“ – und wieder „ein kurzer Auszug“. Hatte das Ulysses-Extrakt die Faszination, die der Segen der Erde in mir geweckt hatte, noch verstärkt, so wurde ich jetzt, nachdem ich dieses sonderbare Weltliteraturfragment gelesen hatte, vermutlich in einen Zustand versetzt, der von etwas weitaus Stärkerem als Faszination dominiert war. Verwunderung? Ja. Aber der Zustand, um den es hier geht, lässt sich zumindest im Nachhinein besser mit Worten und Sätzen beschreiben, die wir unmittelbar mit der Brutalität der Verliebtheit verbinden. Besessenheit. Da haben wir’s. Ich war besessen von dieser Stimme, die jetzt (in meiner Welt) ihren „Ibscenest nansence“ ausgerufen hatte. Das Echo hallte – und hallte weiter … „Ich will Schriftsteller werden“, hatte ich gesagt. Und ich begann mit dem Schreiben. Ich schrieb „merkwürdige Texte“. Dann las ich Dubliners – in Olav Angells Übersetzung (Gyldendal Norsk Forlag, 1974). Und ich schrieb mehr.
Wie kam es, dass Sie sich an einer Übersetzung von Finnegans Wake versuchen wollten – und was hatten die Verlage dazu zu sagen?
Irgendwann zwischen Januar und Juni 2016 erzähle ich Preben Jordal, dem – damaligen – Herausgeber der Zeitschrift Vinduet, dass ich ein „außergewöhnliches“ Übersetzungsprojekt begonnen hatte. Ich sage, ich würde ihm gerne einen Auszug daraus schicken, die ersten zehn Seiten, und weil dieses Gespräch weder per Telefon noch per Mail stattfindet, ist es natürlich verlockend, sich der lebendigen Schilderung hinzugeben: Herausgeber Jordals entgegenkommendes Äußeres als Ausdruck von Esprit etc. Ja, er will es gerne lesen – und das notwendige Lektorat vornehmen. Das freut mich sehr, und in den folgenden Wochen schließe ich die Arbeit an der norwegischen Fassung des erwähnten Auszugs ab, also die ersten zehn Seiten – oder genauer: an einer Norwegisierung dieser Seiten; diese Seiten in norwegischer Umschrift, eine Arbeit, die mit einer mir vom Verlag Det Norske Samlaget in Auftrag gegebenen Übersetzung parallel läuft; ich dichte Julian Talamantez Brolaskis Ovid-inspiriertes Advice For Lovers nach, ein Buch, das künftige Leser (wahrlich prophetische Worte meinerseits!) aus mehreren Gründen sehr zu schätzen wissen werden.
David Aasen, mein hervorragender Lektor bei Samlaget, hat Brolaskis Genie erkannt und mich gebeten, diese durchgedrehten Liebesgedichte nachzudichten. Wird mir das gelingen? Fallhöhe, Fallhöhe. Wie tief kann man fallen? Dann ist es soweit: Ich schicke den Wake-Auszug, die ersten zehn Seiten der Umschrift, an Herausgeber Jordal. Lektor Aasen ist darüber in Kenntnis gesetzt; in einer Besprechung in seinem Büro erwähne ich das Projekt, und er meint, ich solle es ihm auch gerne schicken, und jetzt also ist es soweit und ich schicke Lektor Aasen den Auszug. Herausgeber Jordal antwortet, das sei für Vinduet durchaus interessant; der Auszug werde in Nr. 4/2016 gedruckt. Lektor Aasen schreibt, Samlaget werde gerne die gesamte Übersetzung veröffentlichen, wenn diese vorliege! Oh, ich schwebe vor Glück. Schwerelos im praktischen Textuniversum. Glück.
Dann schließe ich einen Vertrag mit Samlaget ab und sage sowas wie: „Wenn ich die Finanzierung hierfür auf die Reihe kriege, werde ich bis 2020 damit fertig.“ Die Finanzierung. Auf einen Aufschwung folgt ein Abschwung, und der Abschwung ist eine melancholische Erzählung über Geldsorgen. Na, wer will das Projekt „Finnegans Wake in norwegischer Umschrift“ fördern? Ihr? Nein. Du? Nein. Oder: Sie, mein Herr, O potenzieller Mäzen? Nix. „Nachts war er gierig nach Geld und bekam es nicht.“ Aber 2018 bewerbe ich mich bei der Landbezirksverwaltung von Oppland um ein Stipendium, ich bekomme eine Zusage und 200 000 Kronen. Ergo kann ich ungestört arbeiten, solange das Geld reicht. Aber was sind 200 000 Kronen anno 2018 im ölsprudelnden Königreich Norwegen schon wert? Fragen Sie nicht! Seien Sie ganz der Alte: der „Idealist“, der sich von den stapelnden Rechnungen nicht beeindrucken lässt. Ich schreibe den Kälberich. Ich schreibe über „die anzugtragenden Männer“, waschechte norwegische Kapitalisten in der „Unterwelt“:
2022: Die Singleauskopplung Finnegans Wake: fyrste bok, fyrste kapittel erscheint bei Samlaget. Diese Veröffentlichung bedeutet mir enorm viel. Aufschwung. Und vielleicht gibt es in nächster Zeit mehr Singleauskopplungen, bis die gesamte Übersetzung zwischen zwei Buchdeckeln versammelt ist.
Joyce war ein Schriftsteller mit engen Bindungen zu Irland. Sie sind unweit von Oslo aufgewachsen, im Distrikt Hadeland – einer Kulturlandschaft, die in Ihren Büchern einen zentralen Platz einnimmt, nicht zuletzt im Kälberich, der im Dialekt dieser Gegend geschrieben ist. Welche Rolle spielt Ihre eigene Ortsverbundenheit für die Übersetzung von Finnegans Wake, ein Buch, das auf Englisch verfasst ist, zugleich aber auch in mehreren weiteren dutzend Sprachen?
Auf die Gefahr hin, als engstirniger Lokalpatriot dazustehen, antworte ich: die größte. Meine Ortsverbundenheit spielt für meine Arbeit als Wake-Übersetzer die größte Rolle. Die Hügellandschaft in Hadeland lässt sich mit einfachen romantischen Worten als gottgeschaffene Konkretisierung ästhetischer Ideologie „erklären“. Man kann durch die Gegend wandern, und die ganze Zeit, nicht nur dann, wenn man auf einer Anhöhe steht, erfährt man, wie sich die Landschaft verändert, und da ich mich überhaupt nicht orientieren kann, habe ich mich schon oft komplett verlaufen und bin in den seltsamsten Ecken wieder herausgekommen. „For the record“, ich bin in Lørenskog geboren (A. d. Ü.: in einer benachbarten Kommune, nicht in Hadeland) und habe dort die ersten zwei Jahre meines Lebens verbracht – erinnere mich aber an nichts mehr; für mich ist Lørenskog ein leerer Ort. Hadeland hingegen ist voll, übervoll. „Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt, Horatio“.
Leif, mein Großvater mütterlicherseits, kam von der Westküste; gegen Ende der 1930er war er als frisch ausgebildeter Molkereiarbeiter nach Hadeland gezogen, wo er für den Rest seines Lebens blieb – und von ihm lernte ich, im Fremden das Bekannte zu entdecken; er brachte mir bei, dass die nahe, greifbare Welt gleichzeitig fernliegt und die regulierende Kultur ein wirkungsvolles Trugbild ist … „Meine Ortsverbundenheit“: 18 volle Jahre lang, zwischen 1976 und 1994, lässt sich der Ort überhaupt nicht als „das Hadeländische“ bestimmen (was das auch immer sein mag); nein, will man den Ort definieren, muss man das Geplapper über Identität ignorieren, das lokale Festredner von sich geben. Mein Großvater Leif – der Exilant, der Humorist, der Anarchist – erzählt andere Geschichten. Er übersetzt „Hadeland“ in eine andere Sprache. 1994 ziehe ich nach Oslo und 2011 „wieder heim“ nach Hadeland. Und es ist immer noch wichtig – überlebenswichtig –, andere Geschichten zu erzählen. Im folgenden Auszug aus Finnegans Wake: fyrste bok, fyrste kapittel höre ich den kräftigen Westküstendialekt meines Großvaters:
Arne Garborg hinterließ beim jungen Leif senior einen bleibenden Eindruck. Als alter Mann erinnerte sich daran, als wäre es gestern gewesen: wie Garborg zu Besuch kam. Knudaheio, das Sommerhäuschen des Dichters bei Undheim, war 1899 fertig; Leif wurde 1910 in der Ortschaft Pollestad geboren, Podlest, wie es im lokalen Dialekt heißt, und der Dichter klopft, sagen wir, 1917 an die Tür; Garborg arbeitet an einer Übersetzung, einer Nachdichtung – und in meiner Fantasie muss er Feder, Papier und Bücher genau aus diesem Grund ab und an mal auf Seite legen und durch die Küstenlandschaft Jæren wandern, die er so gut kennt, die Welt seiner Kindheit, und dennoch – nun ja – eine fremde Welt, und er besucht Leute, in Podlest ist er willkommen, er klopft an, die Tür wird geöffnet; es ist Zeit fürs Mittagessen, man lädt ihn ein, aber er will nichts, kommt mit hinein und setzt sich auf einen Stuhl an der Wand, betrachtet die Witwe und die Schar ihrer Kinder, sie essen, reden, und die Kleinen gucken diesen Sonderling, der da sitzt, ohne auch nur einen Mucks zu sagen, neugierig an, aber eben das will er ja: einfach nur dasitzen und die Menschen anschauen – und sie reden hören; denn will er mit seiner Nachdichtung vorankommen, muss er sein Wissen über das Leben der kleinen Leute auffrischen und weitere Untersuchungen zu Gebärden, Sprechweisen und – am wichtigsten von allem – zum Rhythmus der Sprache anstellen, ihrer Musikalität … Die Nachdichtung wird abgeschlossen. Odysseuskvædet [Die Odyssee] erscheint 1918 bei Aschehoug & Co (W. Nygaard). Endlich.
Lassen Sie uns zum Schluss über Ihre Übersetzung der „Bygmester Finnegan“-Passage sprechen. Wie haben Sie diesen Satz in Angriff genommen – und was hat das ganz allgemein über Ihre Arbeit an Finnegans Wake zu sagen?
Wie ich die Sache in Angriff genommen habe? Hier, wie auch sonst überall auf dem Planeten Joyce, geht es darum, sich dem Rhythmus auszuliefern. Ein Freund von mir, der meine Singleauskopplung gelesen hatte, sagte, der „Inhalt“ bereite ihm immer noch Kopfzerbrechen; Finnegans Wake erscheine ihm jetzt genauso rätselhaft wie vorher – aber das Wichtigste, sagte er, sei der Rhythmus, oder wie ihm die Übersetzung das Gefühl vermittelt hatte, in ein rhythmisches „Irgendwas“ versetzt worden zu sein. Also ja, „der Rhythmus bestimmt alles“ – und wir können genauso gut zu Klischees greifen: Der Rhythmus ist der Herzschlag, der Atemzug; der Rhythmus ist die feine Maschinerie, die den Organismus am Leben hält. Das heißt aber natürlich nicht, dass „alles Form“ ist und „der Inhalt nichts“. Erstens: „Rhythmus“ und „Form“ sind nicht synonym. Zweitens: Ein Inhalt kann so beschaffen sein, dass der Rhythmus irgendwann zur Sprache kommen muss; ja, als pädagogische Übung können wir uns einen „Inhalt“ vorstellen (ein Geschehen, eine Botschaft, eine Thematik usw.), der nicht zu trennen ist von seinem Schöpfer, dem Rhythmus. Wer so einen Inhalt deutet, muss sich (früher oder später) zur Funktionsweise, zur Handlung dieses Rhythmus äußern (zum Geschehen des Rhythmus, seiner Botschaft, seiner Thematik usw.).
Sagen wir, dass sich die Teilnehmenden unserer Vorstellungsübung ausgerechnet auf Finnegans Wake als sprechendes Beispiel einigen: Inhaltlich ist der Roman ein Herzschlag, ein Atemzug … Aber genug hiervon; wir lassen unsere fiktiven Leser:innen so viele pädagogische Übungen machen, wie sie lustig sind. Dass der „Rhythmus alles bestimmt“ – das ist für mich so selbsterklärend, dass ich vergesse, mir darüber „den Kopf zu zerbrechen“. Was bedeutet es – eigentlich –, dass „der Rhythmus alles bestimmt“? Bedeutet es – eigentlich –, dass das Wissen, das über Jahrhunderte zu den Versfüßen gehört hat, ein Wissen, zu dem viele Schriftsteller:innen (und Übersetzer:innen) von heute kein bewusstes Verhältnis mehr zu haben scheinen, immer noch zu einer Definition der Dichtung imstande sein wird? Eine ungeschickt formulierte Frage, dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Ungeschickt und unrhythmisch, aber trotzdem, glaube ich, in Kontakt mit dem, was irgendwann zur Sprache kommen muss.
Wenn wir uns also über den langen „Bygmester Finnegan“-Satz unterhalten wollen, diesen langen Satz, der durch seine weit ausgreifende Klammer zu einer lustigen Erzählung eines mehr oder minder missglückten Versuchs gerät, ein Bild der Zukunft heraufzubeschwören (die unmögliche Kunst des Schicksals und der Weissagung), ja, wenn wir uns über diesen Satz unterhalten wollen, dann sollten wir ganz einfach auf das erste Wort, die erste Referenz des Satzes hinweisen, anstatt die Wirkung einer Lesart hervorzuheben, in der Joyce im Angesicht seines eigenen Spiegelbilds „the future of his fates“ erkennen will. Das Wort „bygmester“, so buchstabiert und nicht anders (eine zeitgemäße Variante würde „byggmester“ lauten) bringt uns unmittelbar auf die Spur von Henrik Ibsens Baumeister Solness. Das ist der unmittelbare Verweis. Unmittelbar. Und welchen „Inhalt“ transportiert diese Referenz? Nun, bestimmt erinnern wir uns daran: wie Ibsens Baumeister von seinem eigenen Gebäude in den Tod stürzte. Und bestimmt wissen wir noch, wie das alte Lied „Finnegan’s Wake“ (mit Apostroph) nicht nur den Fall, sondern auch die Wiederauferstehung beschreibt. Hier sind die zweite und die letzte Strophe im englischen Original (der Text ist nicht ins Deutsche übersetzt, A. d. Ü.):
„Bygmester Finnegan“: Natürlich hat der Verweis auf den Baumeister Solness etwas über Joyces große Bewunderung von Ibsen zu sagen. Aber diese Verquickung von Finnegan aus dem Lied mit Ibsens „Baumeister“ bringt vermutlich ebenso eine gelinde gesagt sarkastische Haltung zum Ausdruck: Baumeister Solness stürzt in den Tod. Finito. Baumeister Finnegan stürzt in den Tod. Nix finito. Ganz anders als Ibsen, der sich damit begnügt, den Herrn Baumeister sterben zu lassen, führt Joyce ein Requiem auf, in dem sich die Verzweiflung im galgenhumoristischen Wiederauferstehungsaugenblick auflöst. Die Referenz hat sich aus dem unmittelbar vorliegenden Material ergeben: Die christliche Wiederauferstehungsgeschichte haucht diesem (post-)ibsenschen Charakter neues Leben ein. Ibsen kam zu kurz – am Ende des Stücks ist der Punkt des Todes ein Faktum. Joyce hingegen treibt mit dem Grabesernst des Lehrmeisters seine Späße und lässt den sonderbaren Leichnam eines sogenannten Baumeisters von den Toten wiederauferstehen … Ja, hier haben wir wirklich einen „Inhalt“, der uns unter Umständen Kopfzerbrechen bereitet. Lange und ausgiebig. Denn ebendieses Thema – Fall, Tod, Auferstehung – hat ja schon viel Kopfzerbrechen bereitet.
Das Christentum verkündet die Botschaft; zweitausend Jahre lang hat man über Fall, Tod und Auferstehung geredet. Ein kolossaler und bedeutungsvoller „Inhalt“ – den Joyce hier in Angriff nimmt … Wieso? Weil er es muss? Weil die christliche Botschaft … unverständlich ist? Hö, hö! Entschuldigung, dass ich lache, aber genau jetzt tritt der Humor ernsthaft ins Bild „Unser christliches Kulturerbe“: Diese Fall-Tod-Wiederauferstehungs-Verquickungen haben wir geerbt; wir werden alle von diesen widersprüchlichen Denkmustern und ebenso widersprüchlichen Gefühlsregistern heimgesucht – also wieso nicht humoristisch zur Tat schreiten und mit einem Lächeln die vielen seltsamen Zeichen der Heimsuchung deuten? Wer witzelt, hat keine Angst vor dem Deuten. Wer witzelt, hat keine Angst, einen Fehler zu machen. Natürlich kann das Ergebnis der deutenden Tätigkeit eine gigantische Fehllektüre des „Inhalts“ sein, den sie:er geerbt hat – aber na und? Ist es denn nicht sehr wahrscheinlich, dass der Inhalt bereits falschgelesen worden ist? Oder: Dass der „Inhalt“ in Wahrheit eine Fehllektüre, Transformation, Verzerrung ist? Ein buchstäbliches Sammelsurium? Und was, wenn wir dieses Sammelsurium als … Rhythmus bezeichnen?
Der Humorist Joyce deutet die vielen merkwürdigen Zeichen, und in seiner literarischen Welt lässt er den ererbten „Inhalt“ in einer rhythmischen und „unverständlichen“, einer traumähnlichen Sprache hervortreten, die immer wieder – ja – zwischen Gegensätzen von „auf“ und „nieder“ aufersteht. Erneut die weit ausgreifende Klammer: erst die Fresse in einen Zuber; dann wieder hoch – und bald zieht uns wieder etwas mit nach unten. Folgen Sie dem Rhythmus, und Sie werden immer wieder erfahren, wie Finnegans Wake das entscheidende christliche Ereignis (Gottes Tod und Wiederauferstehung) aktualisiert. Über Joyces Meinung zum Christentum lässt sich vieles sagen – aber darüber müssen wir ein andermal sprechen, denn so langsam läuft die Sanduhr ab, nicht wahr?