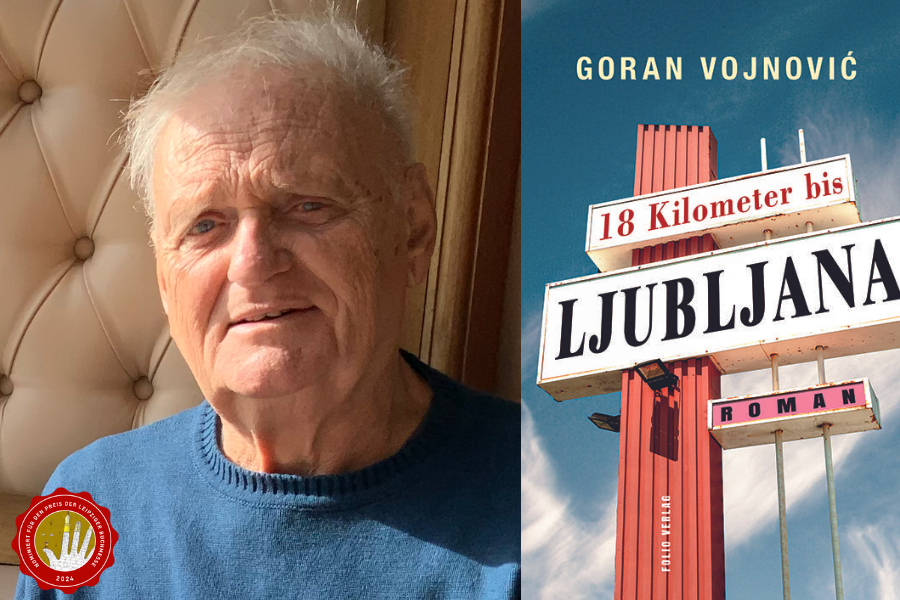In diesem Jahr sind, soweit ich das überblicke, drei Lyrikbände in ihrer Übersetzung erschienen. Sie haben Gedichte von Dylan Thomas, Ted Hughes und Margaret Atwood, deren Gedichtsammlung Innigst / Dearly vor Kurzem auf Deutsch erschienen ist, übertragen. Wie entscheiden Sie, wen und was Sie übersetzen?
Jan Wagner: Es käme sogar noch der italienische Lyriker Federico Italiano hinzu; eine Auswahl aus seinem Werk habe ich gemeinsam mit Raoul Schrott übersetzt. Und vor knapp einem Jahr erschien auch der letzte Lyrikband des wunderbaren irischen Dichters Matthew Sweeney, Der Schatten der Eule. Anzumerken wäre zudem, daß ich von Dylan Thomas nicht die Gedichte, sondern sein gleichfalls herrliches Hörspiel Under Milk Wood ins Deutsche übertragen habe, das freilich höchst poetisch ist und auf begeisternde, virtuose Art alles zu nutzen versteht, was die englische Sprache an Musik und Bedeutungsreichtum zu bieten hat. Oft übersetze ich Autoren, die ich seit Jahren lese und verehre, gelegentlich fragt ein Verlag (oder auch eine Zeitschrift) an, ob ich nicht eine Übersetzung dieser Lyrikerin oder jenes Lyrikers reizvoll finden könnte. Im Idealfall kommt natürlich beides zusammen.
Was unterscheidet Atwood stilistisch von anderen englischsprachigen Dichter:innen, die Sie noch übersetzen?
Während bei Hughes die Energie, der Schwung und Überschwang des Schaffensprozesses spürbar bleiben sollte und seine unbändige Lust am Klang, nicht zuletzt an der Alliteration, während beispielsweise Simon Armitage auf hintergründige Weise mit der Formtradition der englischen Poesie spielt und bei einem Dichter wie Dylan Thomas gleich Satz für Satz und Zeile für Zeile sämtliche Register auf einmal gezogen werden, könnte man bei Margaret Atwood dem ersten Eindruck erliegen, daß es sich um freie Verse handele. Das stimmt einerseits, und die Offenheit, das jeden Leser Willkommenheißende ihrer Gedichte, ein manchmal erzählerischer oder fast parlierender Gestus sind Teil der großen Anziehungskraft, die ihre Gedichte für mich haben (und den folglich auch die deutschen Übersetzungen haben sollten), aber natürlich ist kein Vers eines guten Gedichts jemals frei, auch wenn auf Strophenformen oder regelmäßige Metren verzichtet wird.

Bei aller Zugewandtheit fällt dann allerdings rasch auf, daß Reime und Refrain durchaus eine Rolle spielen, auch wenn sie zunächst, was nur die immense Kunstfertigkeit beweist, nicht auffallen mögen. Hinzu kommt, scheint mir, ein Faible für Wortspiele, für puns, für das Spiel mit den Bedeutungsebenen der Wörter, ihre Doppel- und Dreifachbedeutungen, gelegentlich in Verbindung mit solchen Wörtern, die kaum mehr geläufig sind und die subtil auf ihren Gehalt, ihre Geschichte, ihre Ebenen hin untersucht werden. Die Gedichte verbinden also eine Leichtigkeit im Ton und in der Ansprache an ihre Leser mit einer großen, dabei nie zur Schau gestellten Präzision im Rhythmus, im Timing, und mit einer Freude an der genauen Benennung, am Detail. „So hard to describe the smallest details of flowers“, heißt es in einem Gedicht bezeichnenderweise: „This is a stamen, nothing to do with men. / This is a pistil, nothing to do with guns. / It’s the smallest details that foil translators / and myself, too, trying to describe.“
Wie haben Sie diese Stelle dann übersetzt?
„So schwer fällt das Beschreiben all der winzigen Blumendetails. / Dies sind die Stamina, das hat nichts zu tun mit Ausdauer. / Dies sind die Pistille, das hat nichts zu tun mit Schußwaffen. / Es sind die winzigen Details, die Übersetzern einen Strich / durch die Rechnung machen, auch mir beim Beschreiben.“ – Es ging also darum, im Deutschen ein ähnliches Mißverständnis, eine ähnlich naheliegende wie falsche Fehldeutung zu ermöglichen wie im Englischen. „Pistille“ ist dankenswerterweise gleich nah dran an der „Pistole“ wie im Englischen, aber die „men“ in „stamen“ haben keine Entsprechung als „Männer“ in „Stamina“, so daß ein anderer kreativer wie nachvollziehbarer Irrtum aushelfen mußte.
Thematisch lässt sich Atwoods Gedichtband kaum einordnen. Es gibt Naturgedichte und Liebeslyrik, aber auch Gedichte über Zombies oder eine Übersetzerkonferenz. Wie würden Sie den Band charakterisieren?
Es stimmt, der Band bietet Naturgedichte, nicht zuletzt allerdings solche über unser gestörtes (und zerstörerisches) Verhältnis zur Natur (etwa in einer „Plastizän-Suite“). Thematisch kommen so unterschiedliche Dinge wie Drohnenkrieg, Rollenbilder und Stereotypen, aber auch Überraschendes wie Spätfilme mit Außerirdischen, Werwölfe, „Nacktschneckensex, doppelt verkoppelt“, zur Sprache, dazu Kassandra, die Skythen, Septemberpilze und Halloweenkürbisse. Und sehr viele Vögel, wie Margaret Atwood selbst im kurzen Vorwort, einem Brief an die Leser, anmerkt. Anspielungen auf den Wizard of Oz tauchen ebenso auf wie solche auf Märchen und Mythen. Den Grundton aber, meine ich, setzen in diesem neuen Band Gedichte des Verlusts und der Trauer, Zeilen an geliebte und verlorene Menschen, Gedichte über Zeit, Alter, Abschied.
Lyrik gilt gemeinhin als besonders schwer zu übersetzen. Gab es Stellen in diesem Band, die zunächst „unübersetzbar“ schienen? Und was waren reizvolle Elemente?
Daß nicht selten Reime zu beachten waren, auch hier und da eine Liedstruktur eingebaut wird, hatte ich ja bereits erwähnt – und natürlich sollte all das nach Möglichkeit auch in der deutschen Übertragung erkennbar bleiben (und ist es hoffentlich auch). Eine solche formale Treue ist mitunter knifflig, kann auch, wenn die Mühen der Übersetzung allzu deutlich erkennbar werden, problematisch sein, ist meiner Ansicht nach jedoch gleichzeitig eine Notwendigkeit und noch dazu vergnüglich. Um aber solche Stellen zu nennen, für deren Lösung besonders lange Spaziergänge nötig waren, ein, zwei Beispiele: In einem Gedicht über Werwölfe, wo es über die übergriffigen Monster (und Männer) vermeintlich entschuldigend heißt, sie hätten doch nur „a canid sense of humour“, schien mir im englischen Wort „canid“ (also: hundeartig, hündisch) das Wort „candid“ (freimütig, offenherzig) anzuklingen, was alle Ebenen mit, nun: Biss zusammenführt; im Deutschen haben die Übeltäter jetzt „einen Rüden-Sinn für Humor“.
Dann war da das schöne Spiel mit nurmehr selten anzutreffenden Wörtern wie „reft“ (also „bar“ wie in „bar jeder Vernunft“) und „asunder“ (auseinander, entzwei), wo es nicht nur galt, deutsche, dabei ebenfalls leicht antiquierte Entsprechungen zu finden, sondern ganz wie Margaret Atwood mit den Klängen und Anklängen dieser Wörter zu spielen, wenn sie in „asunder“ die Sonne („sun“) entdeckt und hernach das Wort zu „a minor sunset“ umdeutet, um das Bild dann fortzuspinnen; hier reichte eine wörtliche Übersetzung wie „entzwei“ nicht aus, mußte vielmehr über „zwei“ und „zwi“ zum „Zwillich“ und damit zum „Zwielicht“ gelangt werden, um die Übersetzung zu retten. Es sind dies wohl jene Freiheiten, die man zu nehmen sich aufraffen muß, oder anders gesagt: Gelegentlich muß man dem Wortsinn des Originals untreu werden, um dem Gedicht als ganzem treu bleiben zu können. Und wenn im Englischen der amerikanische Zirkus „Barnum“ als Inbegriff, als Synonym von „Zirkus“ gesetzt wird, sein Name aber einem deutschen Publikum weit weniger, vielleicht nichts, jedenfalls nicht genug sagt, darf, ja muß man sich, glaube ich, für die Übersetzung „Sarrasani“ entscheiden.
Im Zentrum steht das Gedicht „Dearly / Innigst“, das dem Band seinen Titel verleiht. In dem Gedicht werden die verschiedenen Kontexte, in denen „dearly“ im Englischen verwendet werden kann, aufgegriffen und das Wort „dearly“ wird mehrfach wiederholt. Wie sind Sie bei der Übersetzung des Gedichts vorgegangen?
Zweierlei stand für mich fest: Das englische „dearly“ mußte auch im Deutschen mit einem einzigen Wort wiedergegeben werden, also nicht gelegentlich mit „inniglich“ oder einer anderen denkbaren Übersetzung, und dieses deutsche Wort mußte wie „dearly“ einen leicht unzeitgemäßen Klang haben, genau wie das zweite herausgehobene Wort, „sorrow“ oder „Gram“, denn es heißt ja nicht umsonst im Gedicht: „Gram: ein weiteres Wort, / das man nicht mehr oft hört.“ Zu entscheiden war überdies, wo die Wendung „dearly beloved“ des Originals im Singular oder im Plural stehen sollte, denn das Gedicht schreitet ja von der einen angesprochenen Person, dem verlorenen Geliebten, zu all den anderen Verlorenen fort. Wen spricht das Gedicht also an, wenn es heißt: „You know what I mean“ – den Liebsten, sämtliche Verschollene, den Leser, gar alle Leser?
Einige Gedichte wie „The Aliens arrive / Die Außerirdischen landen“ oder „Everyone Else’s Sex Life / Das Geschlechtsleben aller andern“ sind sehr ironisch. Wie herausfordernd war es, den Witz solcher Gedichte ins Deutsche zu bringen? Humor kann ja bekanntermaßen recht kulturspezifisch sein.
Margaret Atwoods Gedichte sind gelegentlich komisch, immer aber gewitzt, scheint mir, und ihr Humor ist oft schmerzhaft treffsicher. Nach den Reaktionen des Publikums zu urteilen, erst recht, wenn Frau Atwood selbst ihre Gedichte vorträgt, läßt sich all das problemlos (und mit großem Vergnügen) in andere Länder und Sprachen transportieren.
In dem märchenhaften Gedicht „The Dear Ones / Die Lieben“ kommen u. a. „Gypsies“ vor, die mit „Zigeuner“ übersetzt werden – in beiden Sprachen derzeit sehr umstrittene Begriffe. Wie stehen Sie zu den vielen Debatten über den Umgang mit rassistischer Sprache?
Die Debatten sind wichtig, das Nachdenken über Sprache, ihre Konventionen, Schichten, Abgründe, über Gebrauch und Mißbrauch ist notwendig, und daß man im täglichen Umgang und beim Verfassen von Texten grundsätzlich verletzende Wörter vermeiden sollte, versteht sich von selbst. Allerdings spielt im literarischen Text der Kontext eine nicht unerhebliche Rolle. In dem erwähnten Gedicht „Die Lieben“ heißt es (über eben diese „dear ones“): „Aber wo sind sie? Sie können nicht nirgendwo sein. Früher entführten Zigeuner sie / oder auch Elfen, das kleine Volk“ – und entscheidend ist hier, scheint mir, daß eine frühere Zeit und der Glauben (und Aberglauben) dieser früheren Zeit aufgerufen werden, eine Zeit mit ihrem eigenen Sprachgebrauch zitiert wird, in der ein Wort wie „Zigeuner“ ohne Bedenken genutzt wurde (also in der Regel kein anderes denkbar oder notwendig schien), zumal diese hier mitsamt den Elfen im Grunde Teil der Welt der Mythen und Märchen werden. Es wäre also, was nun die Übersetzung des Wortes angeht, ein Anachronismus, es durch ein anderes zu ersetzen, das aus heutiger Perspektive weniger verletzend erschiene – also, anders gesagt, den literarischen Kontext der zu übersetzenden Passage im Lichte aktueller, wichtiger Diskussionen und mit heutigem Wortwissen aus den Augen zu verlieren. Man muß darauf vertrauen, daß die souveräne Leserin (und der souveräne Vorleser) dies erkennen und einordnen wird.
Sie arbeiten vorrangig als Dichter. Wie viel Jan Wagner steckt in Ihren Übersetzungen?
Erich Fried sagte einmal sinngemäß, daß, wenn ein und derselbe Übersetzer, sagen wir: Shakespeare, Plath und Lorca übersetze, beim Lesen der Eindruck entstehen solle, daß drei verschiedene Übersetzer am Werk gewesen seien. Das ist ein Ratschlag, der mir immer beherzigenswert erschien – auch wenn es ein unerreichbares Ideal sein mag, die eigene Stimme ganz und gar unhörbar zu machen, sich gleichzeitig mit all dem handwerklichen Wissen, das einem zur Verfügung steht, und mit aller Kunst, die einem möglich ist, ganz in den Dienst einer anderen Stimme zu stellen. Aber versuchen muß man es doch.