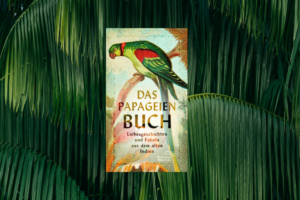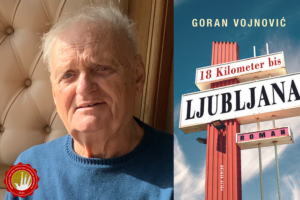Es heißt oft, die Fantasie kenne keine Grenzen. Und da die Literatur aus der Fantasie ihrer Verfasser:innen speist, könnte man dasselbe wohl auch über sie sagen. Doch was Marieke Lucas Rijneveld in dem Roman Mein kleines Prachttier darstellt, bewegt sich nah an der Grenze des Unbeschreiblichen und Unvorstellbaren.
Über Missbrauch und sexualisierte Gewalt wird dank einiger Aufarbeitungswellen zwar mittlerweile häufiger in den Nachrichten berichtet, aber es ist noch immer ein Tabuthema, an das sich auch die Literatur oft nicht herantraut – zumindest nicht in dem selben Maße und auf so bildliche Weise wie Rijneveld: Die Neuerscheinung Mein kleines Prachttier handelt von einem mittelalten Mann, einem Tierarzt, der sich in ein vierzehnjähriges Kind verliebt, sich mit diesem anfreundet, es umgarnt und schließlich missbraucht.
Erzählt wird aus Sicht des Täters, Rijnevelds Leser:innen hängen in seinem Kopf fest. Wir kehren zurück in eine ähnlich trostlose niederländische Ortschaft, wie es sie auch schon in dem mit dem Booker-Prize ausgezeichnete Erstlingswerk gab. Mit dabei ist auch Helga van Beunigen, deren Übersetzung von Was man sät in diesem Jahr den Straelener Übersetzerpreis erhielt. Im Folgenden schreiben wir im Wechsel über unsere Eindrücke während der Lektüre von Rijnevelds zweitem Roman Mein kleines Prachttier. Julia hat die Übersetzung gelesen, Lisa das niederländische Original.
Julia Rosche: Schon als ich mir die Verlagsvorschauen für den Herbst angeschaut habe, bin ich über den deutschen Titel des Romans gestolpert: Mein kleines Prachttier. Man kennt „Prachtexemplar“ oder „Prachtstück“, aber „Prachttier“? Als solches bezeichnet der Ich-Erzähler das junge Mädchen, das er begehrt. Er vergleicht sie oft mit Tieren, daher ist „Prachttier“ eine ungewöhnliche, aber doch treffende Bezeichnung. Der Originaltitel lautet allerdings Mijn lieve gunsteling. Welche Bedeutung hat „gunsteling“?

Lisa Mensing: Würde man „gunsteling“ wörtlich ins Deutsche übersetzen, wäre „Günstling“ die naheliegende Übersetzung. Bei „gunsteling“ schwebt die Bedeutungsebene des „Lieblings“ mit. Allerdings kommen am Ende des ersten Kapitels auch schon weitere Ansprachen hinzu:
Daar staat ze, mijn vurige voortvluchtige, mijn kleine praaldier.
Da steht sie, meine feurige Flüchtige, mein kleines Prachttier.
„Praaldier“ bedeutet „Prachttier“. Offenbar haben sich die Übersetzerin oder der Verlag dafür entschieden, diese Ansprache für den Titel zu übernehmen. „Prachttier“ passt sehr gut zu all den Tieranspielungen, die im Buch vorkommen. Zum Beispiel auch zum Geweih, das als Bezeichnung für das männliche Geschlecht verwendet wird. „Gunsteling“ spiegelt aber vielleicht etwas besser die Beziehung des Mannes und des jungen Mädchens wider, bei der es vor allem um die Anziehungskraft des unschuldigen Kindes an der Schwelle zum Erwachsenenalter geht. „Prachttier“ klingt für mich mehr nach Trophäe.
J.R.: Meine „feurige Flüchtige“ gefällt mir auch gut – eine recht kitschige Bezeichnung. Solche Koseworte stechen heraus, weil sie etwas aus der Zeit gefallen wirken und den Eindruck verstärken, dass man sich im Kopf eines 49-jährigen Mannes befindet, der einen Teenager verführen möchte. Auch der ZEIT ist das aufgefallen. Dort heißt es: „In Mein kleines Prachttier spielt [Rijneveld] mit altmodischen Anredeformen wie ‚Meine himmlische Auserkorene‘ oder ‚Mein Augenstern‘. Man fühlt sich beim Lesen in frühere Jahrhunderte versetzt und ist gleichzeitig der unmittelbaren Gegenwart nah.“ Damit beschreibt Ilka Piepgras aber eigentlich die Wirkung der Übersetzung, nicht die des Originals. Hatte das Original auf dich eine ähnliche Wirkung?
L.M.: An frühere Jahrhunderte habe ich beim Lesen des Originals auf keinen Fall gedacht, aber der Altersunterschied der beiden Personen wird durch diese Formulierungen natürlich deutlich. Für mich hatten sie vor allem den Effekt, dass sie die Besessenheit des Mannes unterstreichen und sein Verhältnis zu dem Mädchen. Mich erinnert das fast an Gollum aus Der Herr der Ringe, der völlig besessen von seinem Schatz ist. Das Mädchen ist hier der Schatz des Tierarztes – eine Art Objekt. In Bezug auf die Kosenamen finde ich es vor allem spannend, dass die deutsche Übersetzung mit „Mein Augenstern“ anfängt. Die ersten Worte im Original lauten „Lieve gunsteling“. In der deutschen Übersetzung kommt das Wort „Günstling“ interessanterweise gar nicht vor. Und trotzdem lauten die ersten Worte der Übersetzung nicht „Mein kleines Prachttier“ – das Muster des Originals wird also durchbrochen, obwohl „gunsteling“ und „Günstling“ in beiden Sprachen ungebräuchlich sind. Die anderen Kosenamen wie „mijn vurige voortvluchtige“ und „hemelse uitverkorene“ wurden aber wörtlich übersetzt.
J.R.: Der Roman ist ein 350-Seiten langer Bewusseinsstrom. Mir fällt kein vergleichbarer Bewusstseinsstrom ein, in dem das „Du“ so präsent ist, normalerweise steht ja das „Ich“ im Vordergrund. Hier aber gibt es einen klaren Adressaten, nämlich das junge Mädchen, das er begehrt. Das „Du“ ist interessant, weil man als Leserin sofort das Gefühl hat, dass die Erzählstimme mit einem redet, was in einem Roman über Pädophilie einen verstörenden Effekt hat. Gleichzeitig ist das „Du“ schwer greifbar, denn im Laufe des Romans wird klar, dass das „Du“ eine Stimme ist, die wir als Leserinnen nicht hören. Das „Du“ ist eine Schöpfung des „Ichs“.
L.M.: Ehrlich gesagt war ich zuerst etwas genervt vom Bewusstseinsstrom. Auf der einen Seite hatte er direkt den verstörenden Effekt, den du ansprichst, da sehr schnell deutlich wird, wer hier spricht, andererseits fiel es mir anfangs schwer, mich diesem Strom hinzugeben. Nach ca. 50 Seiten funktionierte der Gedankenstrom dann aber perfekt und entfaltete all seine Grausamkeit. Ich hatte das Gefühl, dass mein Kopf zuerst einfach nicht in den Kopf des pädophilen Mannes hineinschauen wollte. Hattest du Probleme, wegen des Bewusstseinsstroms in die Geschichte einzusteigen? Rhythmus und Klang sind dafür äußerst wichtig, und im Niederländischen entfaltet der Strom einen wahren Sog, weil die Sätze so gut ineinanderfließen.
J.R.: Ich hatte bei der Übersetzung insgesamt den Eindruck, dass die Kapitel sehr gut strukturiert und in sich sehr geschlossen sind. Die strenge Einteilung verleiht den Gedanken der Erzählstimme einen Rahmen und für uns Leserinnen bietet der Kapitelwechsel einen Moment zum Durchatmen. An gewissen Stellen arbeitet Rijneveld mit recht subtilen Cliffhangern. Überhaupt wird die eigentliche Handlung ja erst Stück für Stück entfaltet, was eine gewisse Spannung erzeugt. Im Deutschen funktioniert der Bewusstseinsstrom auch sehr gut, weil man die Nebensätze schön aneinanderreihen kann und einige eingeschobene Hauptsätze zwischendurch den Faden wieder aufgreifen. Als Übersetzerin braucht man sicher viel Rhythmusgefühl, um da nicht den Faden zu verlieren, aber mit Helena van Beuningen war natürlich eine Expertin am Werk. Vielleicht schauen wir uns ein konkretes Textbeispiel an. Hier findet die Frau des Erzählers heraus, dass er das Mädchen geküsst hat:
[…] maar ik kon je hier niet troosten, niet waar Camillia bij was, en ze zou uiteindelijk kalmeren, ze zou drie clown-ijsjes uit de vriezer halen met van die kauwgombalneuzen in het midden, en ze zou zeggen dat we allemaal wel wat verkoeling konden gebruiken, we zouden de ijsjes ongemakkelijk en zwijgend naar binnen werken terwijl bij jou de tranen nog over je wangen liepen, en ik zag daar weer hoe mooi en jong je was, zo’n prachtig verdrietig kinderfiguurtje met een smeltend clown-ijsje in haar hand, en ik wist dat je even aan It dacht, ik wist dat het ijs je niet smaakte omdat je niet meer van clowns hield, dat je het idee had dat je It had opgegeten en de narigheid nu in jou voortleefde, maar je beet en likte je dapper door het ijs heen en Camillia zei dat het beter was als je niet meer langskwam, je knikte en kauwde lusteloos op de rode kauwgombal, je blies een bel zo groot dat we je gezicht niet meer zagen, tot het verdriet een rode wolk was geworden, je blies tot hij knapte en de helft in de lok van je haar kwam waardoor Camillia de schaar moest pakken en ze zou zien hoe ik verlangend naar je keek, want ik zag plots de vlammen weer in haar ogen opflikkeren toen ze de kauwgom uit je haar knipte, ze liep met je mee tot aan de brievenbus en kon het niet laten om nog bittere woorden uit te spreken: Dat twee mensen van wie ik dacht dat ze van me hielden me dit aan kunnen doen.
[…] aber hier konnte ich dich nicht trösten, nicht in Camillias Gegenwart, und sie würde sich schließlich beruhigen, würde drei Eisclowns mit diesen Kaugummiblasennasen in der Mitte aus dem Gefrierfach holen und würde sagen, dass wir alle ein bisschen Abkühlung gebrauchen konnten, wir würden das Eis unbehaglich und schweigend vertilgen, während dir immer noch Tränen über die Wangen liefen, und da sah ich wieder, wie schön und jung du warst, so eine prachtvolle traurige Kindergestalt mit einem schmelzenden Eisclown in der Hand, und ich wusste, dass du für einen Moment an Es dachtest, ich wusste, dass das Eis dir nicht schmeckte, weil du Clowns nicht mehr mochtest, dass du die Vorstellung hattest, du hättest Es gegessen und das Böse lebe jetzt in dir weiter, aber du bisst und lutschtest dich tapfer durch das Eis, und Camillia sagte, es wär besser, wenn du nicht mehr zu uns kämst, du nicktest und kautest lustlos auf der roten Kaugummikugel herum, bliest eine Blase, so groß, dass wir dein Gesicht nicht mehr sahen, bis aus dem Kummer eine rote Wolke geworden war, du bliest, bis sie platzte und die Hälfte sich in einer Locke verfing, sodass Camillia zur Schere greifen musste, und sie würde sehen, wie sehnsüchtig ich dich anblickte, denn ich sah pötzlich wieder Flammen in ihren Augen auflodern, als sie dir den Kaugummi aus dem Haar schnitt, sie begleitete dich bis zum Briefkasten und konnte es nicht lassen, bitter hinzuzufügen: Dass zwei Menschen, von denen ich dachte, sie liebten mich, mir das antun können.
J.R.: Wie ähnlich sind sich die niederländische und die deutsche Syntax?
L.M.: Generell sind sich die deutsche und die niederländische Syntax sehr ähnlich, was oftmals ein Problem beim Übersetzen ist. Theoretisch kann man fast jeden Satz genau so aufbauen, wie er im Original steht. Allerdings muss man sich oft von der Struktur lösen, um wirklich einen deutschen Text zu erschaffen. Die Ähnlichkeiten der niederländischen und der deutschen Syntax sind für das Übersetzen von Bewusstseinsströmen aber grundsätzlich hilfreich. Ich finde, dass in dem Beispiel die niederländische Version noch ein kleines bisschen besser fließt, wofür Helga van Beuningen aber absolut nichts kann. Im Niederländischen klingt die Kombination aus Präteritum und 2. Person Singular sehr natürlich, im Deutschen kommen ungewohnt klingende Formen wie „du bisst und lutschtest“ dabei heraus, die ich als Leserin etwas störend finde. Aber wie gesagt: Das ist ein Nachteil der deutschen Sprache oder schlichtweg eine in meinen Ohren ungewohnte Kombination.
J.R.: Mir sind solche Formen beim Lesen der Übersetzung auch direkt aufgefallen, weil sie etwas künstlich klingen. Ich glaube, wäre der gesamte Text im Präsens, würde es natürlicher klingen, weil wir eine solche Anrede gewohnt sind. Ich bin beim Lesen tatsächlich darüber „gestolpert“, aber inzwischen denke ich, dass die Sprache zum Erzähler passt, da dieser auch etwas sehr Gekünsteltes an sich hat, etwas Performatives. Dieser Eindruck entsteht, weil er viel fantasiert, sich Szenarien ausmalt, in denen seine „feurige Auserkorene“ vorkommt, und dann tatsächlich auch versucht, diese in der Realität umzusetzen.
L.M.: Findest du die Stimme des Erzählers und die Darstellung des Mädchens authentisch?
J.R.: Die Stimme des Erzählers auf jeden Fall. Wir erfahren viel über ihn, welche Musik er hört, was er mag, auch viel über sein sehr traditionelles Familienleben und seine Vergangenheit. Und es gibt ja noch diese merkwürdige Parallele zwischen ihm und seinem Sohn. Zuerst ist nämlich sein Sohn an dem Mädchen interessiert und macht seinen Vater dadurch eifersüchtig. Diesen Plottwist fand ich zu Beginn seltsam, aber er zeigt letztlich ganz deutlich, wie unangemessen und übergriffig das Verhalten des Vaters ist.
L.M.: Mir kommt der Erzähler auch sehr authentisch vor. Bei der Lektüre habe ich wirklich das Gefühl gehabt, Einblicke in die Denkweise eines Pädophilen zu bekommen. Rijneveld gestaltet diese Einblicke ohne starke Urteile. Das Handeln des Mädchens ist aufgrund der Perspektive schwerer greifbar. Durch das Setting, das schwierige Familienleben und die Irrungen und Wirrungen, mit denen Teenager sowieso zu kämpfen haben, überzeugt sie mich letztendlich aber.
J.R.: Die Darstellung des jungen Mädchens ist etwas komplexer. Ihre Stimme wird von dem „Du“ verdeckt, das eindeutig eine Konstruktion des Erzählers ist. Funktioniert das „Du“ im Niederländischen ähnlich wie im Deutschen?
L.M.: Im Niederländischen ist man das „Du“ gewohnt, da es synonym zu unserem „man“ verwendet wird, das niederländische „je“ funktioniert oft wie das englische „you“. Allerdings wird hier sehr schnell deutlich, dass eine konkrete Person gemeint ist – also doch ein „Du“. Marieke Lucas Rijneveld ist es gelungen, trotz der gewählten Perspektive beide Seiten darzustellen. Allerdings haben wir es mit einem Erzähler zu tun, dem wir absolut nicht trauen können. Trotzdem hatte ich beim Lesen auch das Gefühl, dass sehr deutlich wird, was das Mädchen empfindet. Ging es dir ähnlich?
J.R.: Ja, das lag vor allem an der Prozessgeschichte. Es wird im Zuge des Romans klar, dass es ein Verfahren gegen den Erzähler gegeben hat und das Mädchen eine Aussage gemacht haben muss, die seiner Darstellung der Ereignisse widerspricht. Er schreibt rückblickend über die Ereignisse und man merkt sehr gut, dass ihre abweichende Wahrnehmung ihn irritiert. Diese andere Perspektive, die wir nur indirekt erfahren, schimmert manchmal durch, zum Beispiel, wenn er sie vergewaltigt und sich im Nachhinein nicht sicher ist, ob auf ihrem Gesicht sein Schweiß oder ihre Tränen zu sehen sind:
[…] ik wist alleen nog dat mijn zweet in je hals drupte, dat je een parelketting om je hals had van druppels, dat ik na een paar minuten mijn gewei uit je haalde en dat op dat moment de poster van Beatrix losliet en naast ons dwarrelde, dat ik niet aan de koningin wilde denken, niet aan haar, dat ik zei dat ik van je hield en toen mijn kaken op elkaar beet en mijn zaad op je buik spoot, en je keek er eerst angstig naar en toen verwonderd, het zou je een nieuwe fascinatie geven naast het staand kunnen plassen, en ik had me hijgend naast je neer laten vallen op het matras, langzaam was je weer tot leven gekomen, ik wachtte tot je ging praten, maar je zei niets en ik dacht dat je wangen nat waren van mijn zweet, nat van mijn dauw, maar later twijfelde ik daaraan, ik twijfelde of je huilde, en toen het te lang stil bleef pakte ik mijn aktetas, ik haalde er wat uierdoekjes uit en wreef je buik liefdevol schoon […]
[…] ich wusste nur noch, dass mein Schweiß dir auf den Hals tropfte, dass du eine Perlenkette aus Tropfen um den Hals trugst, dass ich nach einigen Minuten mein Geweih aus dir zog und dass sich in diesem Moment das Poster von Beatrix löste und neben uns herunterflatterte, dass ich nicht an die Königin denken wollte, nicht an sie, dass ich sagte, ich liebte dich und dann die Kiefer aufeinanderpresste und meinen Samen auf deinen Bauch spritzte, und du schautest erst ängstlich und dann verwundert darauf, es sollte eine neue Faszination für dich werden neben der Fähigkeit, im Stehen zu pinkeln, und ich hatte mich keuchend neben dir auf die Matratze fallen lassen, langsam war wieder Leben in dich gekommen, ich wartete darauf, dass du wieder was sagtest, aber da kam nichts, und ich dachte, deine Wangen seien nass von meinem Schweiß, nass von meinem Tau, doch später zweifelte ich daran, ich zweifelte, ob du vielleicht weintest, und als es zu lange still blieb, nahm ich meine Aktentasche, zog ein paar Eutertücher heraus und rieb dir den Bauch liebevoll sauber […]
Spätestens hier ist ganz klar deutlich, dass das „Du“ anders empfindet als der Erzähler – die Passivität charakterisiert sie als Opfer. Zwar sagt der Erzähler „er zweifelte später“ an ihrer Reaktion, als er im Gefängnis ist, aber einige Formulierungen wie „dann die Kiefer aufeinanderpresste“ und „du schautest erst ängstlich“ suggerieren, dass er sich auch in dem Moment bewusst war, welche Gewalt er ausübt. Diese Gewalt ist ein wichtiger Bestandteil seiner pseudoromantischen Faszination.
L.M.: Pseudoromantische Faszination – das trifft es sehr gut! Und das Beispiel zeigt perfekt, wie es Rijneveld gelingt, beide Perspektiven darzustellen. Die Perspektive des Täters (der nur bedingt als Täter dargestellt wird) wird konkret geschildert und durch das Du wird die Perspektive des Opfers indirekt, aber trotzdem sehr deutlich dargestellt. Der Täter führt einen ständigen Dialog mit sich selbst und mit dem Mädchen. Er kämpft gegen sich selbst, gegen sein verbotenes Verlangen, und verliert. Einerseits hat er in der hier dargestellten Szene bekommen, wonach er sich so lange gesehnt hat, andererseits hat er gegen sich selbst verloren.
J.R.: Der Roman könnte überall spielen. Im Text essen sie zwar irgendwann ein Wurstbrötchen bei HEMA, ansonsten hatte ich aber beim Lesen der Übersetzung nicht unbedingt den Eindruck, dass wir uns in den Niederlanden befinden. Die literarischen und popkulturellen Einflüsse stammen vorrangig aus dem anglophonen Raum. Und selbst der Handlungsort trägt im Deutschen einen englischen Titel: the Village. Sind diese Anspielungen typisch für Rijneveld oder ist der Einfluss der amerikanischen Popkultur in den Niederlanden noch größer als bei uns?
L.M.: Im Original heißt der Ort ebenfalls the Village. Ich habe gelesen, dass Rijneveld sich bewusst gegen einen realen Ort entschieden hat, da Rijneveld selbst ähnliche Erfahrungen wie die Protagonistin mit einem Lehrer gemacht hat. Es könnte also eine Entscheidung zugunsten der Anonymität gewesen sein. Gleichzeitig ist der Ort meiner Meinung nach bewusst raum- und zeitlos gehalten, da Missbrauch überall stattfinden kann. Was die anderen popkulturellen Einflüsse angeht, werden die Niederlande sicher stärker vom anglophonen Raum beeinflusst, das fängt schon mit den Synchronisierungsgewohnheiten an. Während deutsche Kinder mit synchronisierten Serien und Filmen aufwachsen, wird im niederländischen Fernsehen vieles nur untertitelt, sodass die Kinder schnell mit der englischen Sprache und Kultur in Kontakt kommen. Ich denke aber, dass Rijneveld als Kind der Neunziger viele persönliche Details mit eingebaut hat. Alles, was diese Generation, zu der wir beide ja auch gehören, beeinflusst hat, findet man in den beiden Romanen wieder. Die Sims haben Rijneveld zum Beispiel stark geprägt, wie man an der Kurzgeschichte Bella and Lucas gut sehen kann.
J.R.: Waren dir die ganzen Anspielungen manchmal zu viel? Hin und wieder habe ich mich beim Lesen gefragt, ob es diese ganzen Verweise wirklich braucht und wie viel sie zur Charakterisierung beitragen, gleichzeitig fand ich sie auch sehr unterhaltsam. Dabei wird der Altersunterschied sehr deutlich: Sie hört Avril Lavigne, er Frank Zappa. Die beiden Charaktere scheinen vor allem über Musik zueinander zu finden. Daher wurden unzählige Zitate aus englischen Songtexten in den Text eingearbeitet. Diese hat van Beunigen auch nicht übersetzt, was sicher albern gewesen wäre, weil die Leser:innen die Songs sonst nicht wiedererkannt hätten.
L.M.: Zum Glück wurden die Songtexte nicht übersetzt, das hätte ich sehr merkwürdig und unsinnig gefunden. Mir gefallen die popkulturellen Verweise. Filme, Bücher und Musik haben eine große Wirkung auf Teenager, was das Beispiel weiter oben sehr gut zeigt. Die ganzen Songs kann man sich als Playlist zum Roman zusammenstellen, wodurch die Immersion nur verstärkt wird. Ich mag das! Neben den popkulturellen Verweisen sind mit Sicherheit auch die Fachtermini aus der Welt der Kühe eine Besonderheit des Romans. Wie funktionieren diese ganzen Fachtermini in der Übersetzung? Schon auf der ersten Seite wird man damit konfrontiert. Hat dich das irritiert, oder fügen sie sich in der Übersetzung gut in den Text ein?
J. R.: Ich finde den Bezug zum Tierreich generell interessant. Vor Jahren habe ich mich im Studium mit Carol J. Adams The Sexual Politics of Meat beschäftigt. In dem Buch zeigt sie auf, dass sich schon die frühen Feministinnen des 19. Jahrhunderts mit der Rolle von Tieren beschäftigten, weil sie diese ebenfalls als Opfer des Patriarchats identifizierten. Oftmals ist Gewalt gegenüber Tieren in der Literatur zudem eine Metapher für häusliche Gewalt. Wenn der Hausherr den Hund tritt, leiden weibliche Figuren oft mit. Man könnte das als eine Form der Empathie lesen, aber eigentlich projizieren sie die patriarchale Gewalt gegenüber dem Tier auf sich (oder haben diese Form der Gewalt bereits erfahren). Viele gegenwärtige Praktiken in der Fleischherstellung und Milchgewinnung sind sehr invasiv. Im Fall von Kühen argumentieren vegane Gruppierungen, dass deren Weiblichkeit ausgebeutet – sie sind dauerhaft schwanger, um dauerhaft für uns Milch produzieren zu können. Ich denke, das sind alles Motive, mit denen Rijneveld bewusst arbeitet. Trotz der Fachtermini wird klar: das Leben auf dem Hof ist für die Tiere wie auch für die Jugendlichen ein Leben mit Gewalt. Eine Kuh kann sich während der Besamung durch den Tierarzt nicht wehren, das Mädchen auch nicht. Viele Schilderungen in diesem Roman sind unheimlich brutal, zum Beispiel diese Stelle, wo es um die Folgen der Maul- und Klauenseuche geht:
[…] ze zou de beelden die ik voor me zag onmogelijk kunnen begrijpen, de beelden waarin de veehouder niet aan de trap maar aan de voersilo hing, waarin hij zo blauw zag als een kruisdistel en uit zijn mond een laatste doodsrochel kwam, het galmde door mijn kop terwijl ik mijn handen tegen mijn oren drukte, en op de achtergrond hoorde ik het geloei van de koeien die door de schutters in de hoek werden gedreven en soms pas na een paar schoten in elkaar zakten, ik zag de grijparmen achter de voersilo opdoemen, die halfdode schapenlijven aan hun poten vasthielden […]
[…] sie würde die Bilder, die ich vor mir sah, unmöglich verstehen können, die Bilder, auf denen der Viehbauer nicht an der Treppe, sondern am Futtersilo hing, auf denen er so blau aussah wie eine Edeldistel, aus seinem Mund kam ein letztes Todesröcheln, es hallte in meinem Kopf, während ich mir die Hände an die Ohren presste, und im Hintergrund hörte ich das Brüllen der Kühe, die von den Schützen in die Ecke getrieben wurden und manchmal erst nach mehreren Schüssen zusammenbrachen, ich sah die Greifarme der Frontlader hinter dem Futtersilo aufragen, die halbtote Schafsleiber an den Beinen hielten […]
Die Fachtermini sind mir nicht negativ aufgefallen – im Gegenteil. Das Klinische passt für mich sehr gut zur der Erzählstimme, gleichzeitig entsteht dadurch eine gewisse Distanz, da es gerade den Gewaltdarstellungen eine verstörende Kühle verleiht. Eine solche Darstellung ist nicht allzu ungewönlich. In Serien haben die Mörder ja oft ähnliche Jobs, Hannibal Lecter quält seine Opfer ja auch mit unheimlicher Präzision. Haben die Beschreibungen im Original auf dich sehr technisch gewirkt?
L.M.: Nein, im Original klingt das alles sehr organisch. Als Stadtkind stößt man bei diesen Termini ab und zu an seine Grenzen, aber Rijnevelds Sprache zeichnet sich gerade auch durch diesen kreativen Umgang mit dem Wortfeld der Milchbauernhöfe aus. Ich finde Rijnevelds Sprache und Helga van Beuningens Übertragung eindrucksvoll. Die ersten Sätze gehen gleich in die Vollen:
Ik had je in dat steilorige hoogseizoen als een zweer met een hoefmes uit de klauwlederhuid moeten verwijderen, ik had ruimte moeten maken bij de tussenklauwspleet zodat mest en vuil ertussenuit zouden vallen en niemand je kon infecteren, misschien had ik je enkel wat moeten pellen en bijschaven met de slijper, je moeten reinigen een droogwrijven met was zageling.
Ich hätte dich in jenem verbohrten Hochsommer wie ein Geschwür mit dem Hufmesser aus der Klauenlederhaut schneiden müssen, ich hätte Raum beim Zwischenklauenspalt schaffen müssen, damit Mist und Dreck herausfallen und niemand dich infizieren kann, vielleicht hätte ich dich mit dem Winkelschleifer nur etwas abtragen und nachfeilen müssen, mit etwas Sägemehl säubern und trocken reiben.
J.R.: Ich kann dir da nur zustimmen. Rijnevelds Roman und seine fantastische Übersetzung von van Beunigen haben mich von der ersten Seite an gefesselt – sicherlich aus den bereits genannten Gründen.
L.M.: Bräuchte das Buch deiner Meinung nach eine Triggerwarnung?
J.R.: Auf der einen Seite denke ich, dass dann fast alle Bücher eine Triggerwarnung bräuchten. Es wird immer etwas geben, das einen als Leserin emotional herausfordert. Auf der anderer Seite scheinen aber auch viele Betroffene Triggerwarnungen gutzuheißen, und stören tun sie mich nicht. Da das Buch die Gewalt sehr bildlich darstellt, wäre es vielleicht angebracht. Brauchen wir für diesen Artikel eine Triggerwarnung? Was meinst du?
L.M.: Ich glaube, dass man Triggerwarnungen umgehen könnte, wenn Klappentexte expliziter wären. Auf der deutschen Ausgabe steht ein Zitat aus einer niederländischen Tageszeitung: „Rijnevelds Roman ist ein Triumph. Pulsierende Sätze, zwei symbiotische Stimmen, am Ende weiß man: So fühlt sich Liebe an.“ Deutet dieser Satz nicht etwas völlig Falsches an? Durch den Satz „So fühlt sich Liebe an.“ bekommt man den Eindruck, es handle sich um eine Liebesgeschichte. Und natürlich wird eine Art Liebesgeschichte erzählt, aber bestimmt nicht die Art Liebesgeschichte, die dieser Satz andeutet. Hier wird etwas romantisiert, das auf keinen Fall romantisiert werden darf. Vielleicht schaffen wir es, den Teaser für diesen Artikel so explizit zu gestalten, dass wir keine Triggerwarnung brauchen.
J.R.: Ich finde, Sätze wie „So fühlt sich Liebe an.“ zeigen, warum es Bücher wie dieses braucht: weil in unserer Gesellschaft Missbrauch noch immer verharmlost wird. Das ist keine Liebe, die hier beschrieben wird, sondern eine Obsession, die Fantasie eines kranken Mannes, der ein Kind vergewaltigt. Also ja, lass uns das explizit in den Teaser schreiben.